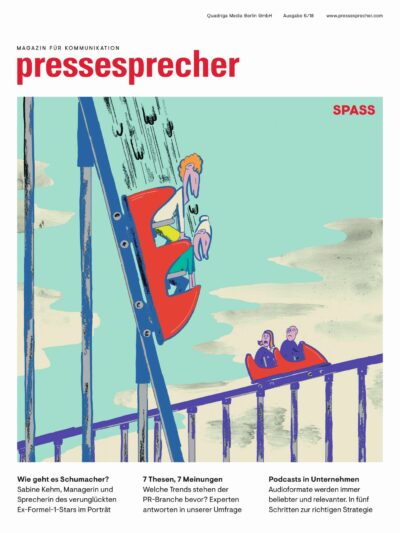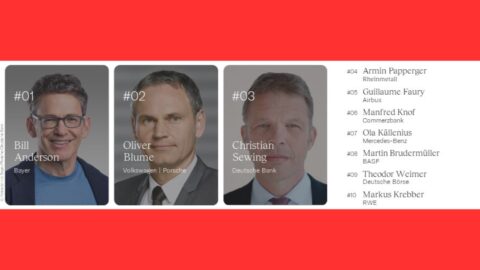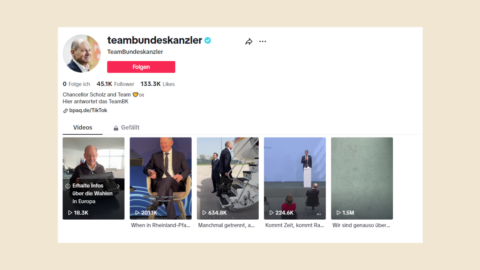Betrachtet ein Astronaut von seinem Raumschiff aus die Erdkugel, so erblickt er als Zeichen des dortigen Lebens die erleuchteten Punkte der nächtlichen Städte. Mit viel Zoom erkennt er außerdem wichtige Verkehrsadern. Was jedoch selbst ein Astronaut nicht sehen kann, ist die alles umspannende Kommunikation der Erdenbürger untereinander.
Ich wollte mehr über das Kommunizieren herausfinden, und so reiste ich los, um in 13 Ländern der Welt diesen verbindenden Puls zu spüren, der die gegenwärtige Transformation vorantreibt. Es ist der Austausch der sich weltweit vernetzenden Menschheit in ihrem zunehmend digital geprägten Lebensalltag in Form von Informationen. Und es sind der stets neue Content und Daten als Futter für die immer mächtiger werdenden Algorithmen.
Auf meinem Weg um die Welt – drei Viertel meiner Stationen zählen zu den größten Metropolregionen – stieß ich häufig auf ein Phänomen, das diesen verbindenden Achsen widerspricht: Ich beobachtete den massiven Rückzug von Menschen in ihre eigene Informationsblase und die geringe Bereitschaft, sich mit Gegensätzlichem auseinanderzusetzen.
Überall auf der Welt leben Menschen in solchen Blasen, die weit über den auf Algorithmen fixierten Begriff der „Filter Bubble“ hinausgehen. In Brasilien etwa traf ich arme Favela-Bewohner. Deren Behausungen verfügen oftmals über keinen Wasseranschluss, stattdessen jedoch – illegal angezapften Stromleitungen sei Dank – über Flachbildfernseher, aus denen sie sich mit Telenovelas dauerberieseln lassen. Diese Sendungen scheinen jedoch eher als Narkotikum denn als Aufstiegsanreiz zu wirken, wie ich auch in Mexiko beobachtete. Am Ende handelt es sich hier doch bloß um eine gefühlte Teilhabe an der Welt der Reichen und Schönen.
Die reale Welt bleibt zunehmend außen vor
Dennoch ist die Aufstiegshoffnung von Menschen generell eine zentrale Triebfeder für ihre Bereitschaft zur Weiterentwicklung. Ihr Verhalten wird durch Kommunikation gezielt beeinflusst. In Indien beschrieb mir der CEO des Ablegers eines international tätigen Unternehmens: „Unsere Zielgruppe möchte Teil der großen weiten Welt sein. Deshalb kauft sie westliche Konsumprodukte.“
Statusorientierte Anschaffungen, auch wenn der Kunde diese eigentlich gar nicht benötigt – es geht ihm, frei nach dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu, um das Nachleben des Lebensstils höherer Schichten. Dieses „Show off“-Verhalten ist an vielen Orten der Welt zu beobachten. Am extremsten fiel es mir im Libanon auf.
Hinweise auf südkoreanischen Bürgersteigen holen den Smartphone-Nutzer zurück in die reale Welt. (c) Georg Milde
In den Industrieländern von Großbritannien bis Japan erlebte ich immer wieder aufs Neue, wie sich die Menschen mit Streamingdiensten, Onlineshopping, Spielekonsolen und Social-Media-Identitäten in ihren jeweiligen Blasen bewegen. Ich bin heute mehr denn je überzeugt: Personifizierte Kaufempfehlungen und ähnliche Annehmlichkeiten werden in den kommenden Jahren ergänzt werden durch zusätzliche Virtual-Reality-Systeme, die den individuellen Vorlieben immer besser angepasst sind. Und außen vor bleibt die reale Welt …
Warnhinweise auf den Gehwegen
Ich denke an meine Ankunft in New York. Kurz nach der Landung kam ich ins Gespräch mit einer Amerikanerin. Die Managerin beklagte, dass die Debatten in den sozialen Netzwerken viel rauer geworden seien. „Da posten nur noch extrem Linke gegen extrem Rechte“, meinte sie und sieht als eine der Ursachen die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten ihres Heimatlands: „Die unterschiedlichen Kreise bleiben zunehmend unter sich.“
Sogar unter Nachbarn würden sich jene mit gegenläufiger Meinung eher meiden. Sie selbst tausche sich daher lieber nur noch mit engeren Kontakten aus. Doch wer nur mit ähnlich denkenden Mitmenschen kommuniziert, fühlt sich von diesen in seiner Meinung bestätigt, bis er diese Meinung gar für die Mehrheitsmeinung innerhalb der Gesellschaft hält.
In Tokio erlebte ich, wie sich solche geschlossenen Räume sichtbar manifestieren: In der sogenannten Electric City begeben sich die vielen Manga-Fans auch äußerlich in die Traumwelten der Rollenspiele. Hunderttausende sogenannte Hikikomori ziehen sich über Jahre hinweg in ihre Wohnung zurück, um dem immensen Erwartungsdruck der japanischen Gesellschaft und deren hierarchischen Traditionen zu entfliehen.
Als eindrückliches Symbol der Schnittstelle zwischen individueller Blase und äußerer Welt blieben mir die Warnhinweise auf den Bürgersteigen in Südkorea in Erinnerung. Kurz vor Kreuzungen bedeuten sie allen auf ihr Smartphone starrenden Fußgängern, dass sie nun wieder die möglichen Gefahren des Straßenverkehrs beachten sollen.
Überwachungsökonomie in der Welt der Algorithmen
Technisch am meisten beeindruckt haben mich die sich rasant entwickelnden Großstädte Chinas. Was jeden Reisenden, der sich eingehender mit dieser Nation befasst, geradezu umwirft, ist die Wucht dessen, was dort gerade entsteht. Im einst kommunistisch geprägten Land steht der Konsument in Reinform im Mittelpunkt. Mittels der großen Plattformen wie Wechat und Alibaba verwaltet er nicht nur seine Kommunikation, sondern gleich – nahezu komplett – sein gesamtes Leben. Von Messengerdiensten bis hin zum Bezahlen, von der Essensbestellung bis hin zum Vereinbaren eines Arzttermins.
Die Macht des Wissens über das Leben der 1,4 Milliarden Chinesen ist enorm. „Das Big-Data-Volumen unseres Binnenmarktes ist das größte der Welt“, sagte mir ein Geschäftsmann in Peking. „Und wenn die anderen mit ihrem Silicon Valley nicht mit uns spielen wollen, dann reicht es, um damit unsere eigenen Fortschritte zu ermöglichen.“
Der chinesische Staat kann auf viele dieser Informationen zurückgreifen. Denn es entsteht ein gläserner Bürger, der in wenigen Jahren durch das geplante Sozialkreditsystem vollkommen skalierbar sein wird. Wer sich staatskonform verhält, sammelt Punkte. Die Gesichtserkennungssoftware der Überwachungskameras an inzwischen Millionen Stellen im öffentlichen Raum weist in dieselbe Richtung. Kritiker sprechen von einer Überwachungsökonomie, die die Macht des bestehenden Systems sowie der neuen Welt der Algorithmen weiter ausbaut.
Was auf einer Reise wie meiner nicht fehlen darf, ist ein Besuch bei einem Internetriesen in den USA: „Wir erforschen hier, wie Produkte gestaltet werden müssen, damit die jeweiligen Zielgruppen zu einer bestimmten Handlung bewegt werden“, berichtete mir ein Mitarbeiter. Am wichtigsten sei der Nutzertyp des „Interested Bystander“ – zu Deutsch: des interessierten Zuschauers. Dieser mache nämlich rund die Hälfte der Bevölkerung und somit der potenziellen Kunden aus.
Letztlich gehe es darum, möglichst viele Barrieren, die einen Nutzer in Passivität verharren lassen, zu beseitigen oder zumindest zu reduzieren. „Wir wollen ihn zur Handlungsbereitschaft erwecken, ihn so gespannt stimmen, bis er sich irgendwann bewegt.“ Und ein Produkt kauft.
Digitalisierung ermöglicht Zugänge
Auf meiner Reise wurde mir eindrücklich bewusst, wie sehr die neuen Technikformen gerade unterprivilegierten Menschen eine Möglichkeit verschaffen, trotz schwieriger Lebensbedingungen erstmals an bestimmten ökonomischen Prozessen teilzunehmen.
Ich erlebte stolze Kenianer in einem riesigen Slum von Nairobi, denen mangels Besitz keine Bank eine Kontoeröffnung erlauben würde, die aber dank eines günstigen Handys erstmals kleine Geldtransaktionen via Mobile-Payment-Systeme vornehmen können. Das ist nicht weniger als der Anfang eines Zugangs zu neuen Chancen.
In Ruanda erfuhr ich, wie die autoritäre Staatsführung GPS-Tracking und andere Methoden nutzt, um die Kriminalität im Gegensatz zu allen benachbarten Ländern offiziell auf nahezu Null zu senken. Aus dem Genozid-Schauplatz von 1994 wurde ein relativ sicherer, stabiler Polizeistaat, in dem auch große deutsche Konzerne investieren und Produktionsstätten eröffnen. Eine Idylle mit Schattenseiten.
In den kommenden Jahren wird es darauf ankommen, die neuen Kommunikationsformen noch stärker an gesellschaftliche Phänomene anzugleichen. Gerade in Ländern wie Indien verbreiten sich Hassbotschaften rasend schnell über Whatsapp und andere Messenger. Gerüchte über vermeintlich kriminelle Handlungen, die in enormer Geschwindigkeit von vielen der Hunderte Millionen Nutzer geteilt wurden, führten in jüngster Vergangenheit immer wieder zu Lynchmobs.
Eine Person in Russland ist mir in deutlicher Erinnerung geblieben: ein schwuler Mann, der mir berichtete, dass es auch in seiner traditionell konservativen Heimat Internetportale sowie Dating-Apps für Schwule und Lesben gebe. „Aber beim Kennenlernen ist da immer diese Furcht, weil es Gruppierungen gibt, die mit Lockprofilen Jagd auf Homosexuelle machen“, sagte er frustriert. „Es kommt dann zu einem Treffen, bei dem der Schwule bloßgestellt wird. Zum Beispiel schert man seinen Kopf und stellt diese Demütigung auch noch als Film ins Internet.“ Letztlich lebe man in latenter Angst.
Das Beispiel aus Russland illustriert: Die modernen Kommunikationsformen sind in der Lage, Streit schnell und weit zu streuen. Professionelle Kommunikatoren, die gegen Hate Speech kämpfen, wissen das.
Nach der Rückkehr von meiner Reise habe ich daher als einen Leitgedanken mitgebracht: Digitale Revolution darf nicht allein bedeuten, dass der Einzelne, die Gesellschaft, die Demokratie immer mehr zu einem konformen, technologiegetriebenen Markt werden. Sondern zugleich bedarf es einer digitalen Emanzipation.
Letztlich wird dies auch Unternehmen und anderen Marktteilnehmern mehr nutzen als manche Fehlentwicklung, die ich während der 13 Wochen rund um die Welt am Wegesrand beobachtete. Die Nutzer müssen lernen, Wahrheit und Fake besser voneinander zu unterscheiden. Und sie müssen selbstbewusst und verantwortungsbewusster als derzeit mit der Vielfalt an Informationen und Meinungen umgehen – innerhalb und vor allem auch außerhalb der jeweiligen Blase.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe SPASS. Das Heft können Sie hier bestellen.