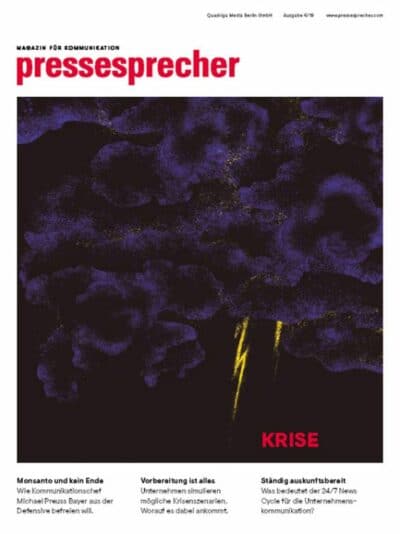„Misere“, „Sackgasse“ und „Schlamassel“ schlägt der Duden als Synonyme für „Krise“ vor. Der Schriftsteller Max Frisch sah das anders: Eine Krise sei „ein produktiver Zustand“, schrieb er. „Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ Dafür gibt es in der Kommunikation Hilfsmittel: Krisenleitfäden zum Beispiel, die Schritte und Verantwortlichkeiten definieren. Oder Krisenübungen, die ein Katastrophenszenario simulieren, um Abläufe zu trainieren. Das kostet zwar Zeit und Geld, lohnt sich für viele Institutionen aber weit über die Krise hinaus.
Für öffentliche Einrichtungen und Behörden sind Krisenübungen unerlässlich. Kommunen, Feuerwehr, Polizei, Ämter und Ministerien proben die Zusammenarbeit bei Umweltkatastrophen, Cyberangriffen oder Pandemien. Versorger oder sicherheitsrelevante Unternehmen sind meist ebenfalls beteiligt. Kommunikation ist stets ein wichtiger Teil, entweder um intern zu informieren, die Bevölkerung zu warnen oder die Information von Medien und Öffentlichkeit über Social Media sicherzustellen.
Seit 2004 trainiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe seine Abläufe im Rahmen von „LÜKEX“, einer ressort- und länderübergreifenden Übung für strategisches Krisenmanagement. Seit 2005 gibt es eine eigene Einheit für Kommunikation: das „Nationale Medienzentrum“. „Echte Journalistinnen und Journalisten“ simulieren eine „echte Medienwelt“, mit Zeitungsberichten, einem Facebook-Pendant („lükbook“) und „LÜKEX TV“, einer fiktiven „Tagesschau“.
Bei derartigen Übungen soll sich alles real anfühlen – auch der Stress. Das ist das Einmaleins der Krisensimulation. Von einem „hilfreichen Schock“ spricht ein Anbieter im Netz: Vielen würde erst durch die Übung bewusst, wie schlecht sie vorbereitet seien. „Schock ist ein hartes Wort. Wir versuchen, ein gewisses Stresslevel aufzubauen, um einen echten Eindruck davon zu gewinnen, wie eine Person in einer Krisensituation reagiert“, sagt Christoph Wegener, Berater der Agentur Kekst CNC und Mitentwickler des „Situation Room“.
Verschiedene Szenarien in Echtzeit testen
Im „Situation Room“ sitzt eine Gruppe in einem Raum zusammen und durchläuft eine inszenierte Krise. Vier bis 40 Personen, zwei bis fünf Stunden lang. Um eine realistische Simulation herzustellen, spricht die Agentur vorab mit „Insidern“. Sie klärt, wo Freigaben fehlen oder Abstimmungen nicht funktionieren, welche Sprachregelungen und welche internen Kanäle es gibt. Alles soll möglichst passgenau sein.
Über ein interaktives Tool werden Reaktionen eingespielt und getestet. „Wir bauen auch fiese Sachen ein“, sagt Wegener. Einen Zahlendreher zum Beispiel, wenn der Kunde eine Hotline kommuniziert und Medien sie falsch publizieren. Wichtig ist, dass der Kunde so etwas mitbekommt, ein Monitoring für Beschwerden betreibt und schnell reagiert. Am Ende werden die Prozesse gemeinsam evaluiert. Was hat geklappt? Was kam zu kurz? Wie war die Zusammenarbeit? Auch wenn es ein geschützter Raum ist, für den Kunden Geld bezahlen, begeben sich nicht alle Führungskräfte in diese Testsituation. Einige bleiben lieber in der Rolle des Beobachters.
Eine Simulation ist kein Assessment-Center. Es gehe nicht darum, einzelne Mitarbeiter zu testen und im Zweifel auszusortieren, betont Wegener. Es geht um Sicherheit und Zusammenarbeit. Beides übt sich schlecht auf Papier. „Wer schwimmen lernen will, muss früher oder später ins Wasser“, sagt er. Im Idealfall regelt man Abstimmungsprozesse intern, bevor eine Krise ausbricht. Die Simulation kann helfen, indem man „Problemabteilungen“ mit ins Boot holt. Zu sehen, wie man gemeinsam eine Krise meistert, kann das Selbstvertrauen stärken. Das ist Wegener zufolge das wichtigste Ziel der Simulation: „Sie schießen ja auch nicht den Elfmeter zum ersten Mal, wenn es darauf ankommt.“
Spontan anberaumte Simulation
Um gut trainiert auf den Platz zu gehen, gehören Übungen bei großen Unternehmen fest ins Programm. Ein Versicherungskonzern, der nicht namentlich genannt werden will, hat sogar eine eigene Software programmiert, um das Verhalten im Krisenfall zu trainieren. Bei EnBW gibt es Krisen-
übungen einmal im Jahr – ohne Vorankündigung und freigeräumten Terminkalender. Das macht sie realistischer. Organisiert werden die Simulationen bei dem Energieversorger vom zentralen Krisenmanagement, das auch die Leitfäden formuliert und den Krisenstab einberuft.
Angela Brötel ist eine der beiden Personen, die bei EnBW für die Krisenkommunikation verantwortlich sind – zusammen mit einem eingespielten Team, in dem jeder eine klare Rolle hat. Eine reine Kommunikationssimulation ist erstmals für 2020 geplant. „Durch Social Media hat sich die Dynamik verändert. Im Zweifel muss ich improvisieren und mein Team neu sortieren. Dafür ist es gut zu wissen, wer im Team welche Stärken hat und eine Rolle übernehmen kann, die gerade unbesetzt ist“, so Brötel.
2017 hat EnBW eine Simulation durchgeführt, um eine kritische Situation zu vermeiden. Der Konzern musste radioaktive Brennelemente aus einem Atomkraftwerk in ein Zwischenlager transportieren. Um zu zeigen, dass der Transport sicher funktioniert, hat EnBW ihn mit leeren, unbenutzten Castoren geprobt und Anwohner, Medien und Stakeholder dazu eingeladen. Die Transparenz sollte helfen, Vertrauen zu generieren, Akzeptanz zu schaffen und Vertrauenskapital anzusammeln.
„Sie können in der Krise nicht Ihre Agenda umdrehen oder eine andere Haltung an den Tag legen als sonst“, sagt Brötel. Will ein Unternehmen in Krisen die erste Anlaufstelle für Informationen sein, muss es auch im Tagesgeschäft glaubwürdig informieren. Will es Vertrauen gewinnen, muss es immer verlässlich sein. Will es sichtbar sein, muss es regelmäßig Gesicht zeigen und den Kontakt mit Stakeholdern suchen.
„Auf die Haltung kommt es an“, sagt Brötel. „Sie ist der Kompass, der einem auch in unerwarteten Situationen die richtige Richtung weist.“ Das macht die Abgrenzung so schwierig. Die Grenzen zwischen Akzeptanzkommunikation, Reputationsmanagement und Krisen-PR verschwimmen. Erst recht, wenn das Netz dafür sorgt, dass eine Kritik in Sekundenschnelle zu einem Sturm werden kann – oft hervorgerufen durch falsche Kommunikation.
Drohende Krisen als Normalzustand
„Shitstorm-Simulationen“ sollen Organisationen dahingehend trainieren, dass sie auch ohne Krisenstab deeskalierend wirken. Regelmäßig proben können das Nahverkehrsunternehmen und die Deutsche Bahn. Sie stehen dank ausgefallener Züge und Verspätungen in der Dauerkritik. Auch der Tiergarten Nürnberg braucht nach eigener Aussage keine Simulationen: Eisbären, Gorillas und vor allem das eigene Delfinarium sorgen regelmäßig für Proteste und Kampagnen. „Was für uns ein Normalzustand ist, wäre für andere eine Krise“, sagt Pressesprecherin Nicola A. Mögel. Ihren Job verdankt sie einem Ausnahmezustand: Als 2007 der Eisbär „Flocke“ zur Welt kam, explodierte die Nachfrage im Zoo. Die Kommunikationsabteilung war überfordert und Mögel wurde als Pressesprecherin engagiert. Für die Stadt war das per definitionem eine „Krise“ – eine der schöneren Art.
Im Tiergarten gibt es Krisenablaufpläne und einen Krisenstab. Je ernster die Lage, desto weniger Personen treten nach außen auf. Wenn ein Raubtier ausbricht, gelte für alle außer der Direktion „Redeverbot“. Auch der Bürgermeister ist Mögel zufolge krisenfest: „Ich wüsste nicht, was ich ihm durch eine Simulation beibringen kann.“ Die Texte erstellt sie selbst, zur Not hilft ein freier Journalist, der den Zoo als Autor der „Tiergarten-Zeitung“ unterstützt. Vorgefertigte Textbausteine hätten sich nicht rentiert. Andere greifen gerne auf solche Bausteine zurück und können sich nicht vorstellen, in einer Krise auch noch operativ tätig zu sein. Laut Wegener ist das eine häufige Erkenntnis aus dem „Situation Room“: Vorbereitung ist notwendig.
Einiges können Simulationen testen und trainieren. Anderes müssen Kommunikatoren mitbringen. Für Angela Brötel ist das eine „resiliente Persönlichkeit“: „Wer es gewohnt ist, im Alltag mehrere Bälle in der Luft zu halten und auch unter Zeitdruck fundierte Entscheidungen zu treffen, den bringt auch eine kritische Situation so schnell nicht aus der Ruhe.“
Für Christoph Wegener ist neben Souveränität auch Empathie entscheidend. Beides könne man sich schwer antrainieren. Nicola Mögel hält Mut für wichtig. Als ein Zoo in Dänemark weltweit in der Kritik stand, weil er Giraffen zu Bildungszwecken zerlegt, wies sie darauf hin, dass der Tiergarten Nürnberg ebenfalls Huftiere tötet und verfüttert, auch solche, die unter Artenschutz stehen. Das Gesetz ermöglicht es. Moralisch ist es umstritten. Die Empörung kam wie erwartet. Die Fakten lagen allerdings offen auf dem Tisch. Resultat: Eine Krise blieb aus. „Man darf keine Angst haben, auch kritische Themen anzusprechen und sie mit Selbstbewusstsein zu vertreten“, sagt Mögel. Die beste Vorbereitung für eine Krise ist es eben, den „Schlamassel“ von vornherein zu umgehen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KRISE. Das Heft können Sie hier bestellen.