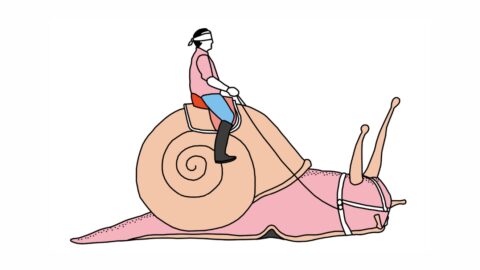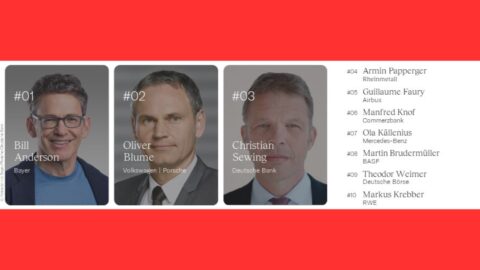Herr Schillinger, der Oetker-Urenkel August Oetker hat 2009 eine Studie zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Auftrag gegeben. Im Oktober 2013 wurden die Ergebnisse präsentiert. Wie haben Sie sich kommunikativ auf die Veröffentlichung der unternehmenshistorischen Studie vorbereitet?
Jörg Schillinger: Vorteilhaft ist es, wenn anfänglich gar nicht kommuniziert wird. Das heißt, die Historiker sollten erst einmal unvoreingenommen und unbedrängt arbeiten können. Man muss aber dennoch ein Statement vorbereitet haben, um offen und ehrlich antworten zu können, falls doch jemand nachfragt. Wir hatten so ein Papier und haben es auch vergangenes Jahr benutzt. Und dann haben wir vor dem Veröffentlichungstermin mit den Historikern gemeinsam abgesprochen, wie wir strategisch nach außen und nach innen kommunizieren. Man sollte langfristig planen und als Kommunikator von Anfang an dabei sein.
Die Presse wusste also nichts von dem Forschungsauftrag und hat erst zwei Jahre später etwas davon mitbekommen?
Es hat sich nur niemand dafür interessiert. Die Studie stand immer im Verzeichnis der Universität Augsburg als Forschungsvorhaben. Als wir dann vergangenes Jahr angesprochen wurden, was wir vorhaben, um die NS-Zeit aufzuarbeiten, konnten wir auf die Studie mit Professor Wirsching verweisen.
Gab es einen PR-Krisenplan?
Nein, den hatten wir nicht. Wir hatten einen Plan, um vorbereitet zu sein, wenn wir gefragt werden. Von einer möglichen Krise konnte zu keinem Zeitpunkt die Rede sein.
Es gab bis auf den Streit um die Kunsthalle in Bielefeld kaum öffentlichen Druck, eine Studie in Auftrag zu geben. Woher kam der Anstoß?
Die Initiative ergriff die Familie Oetker selbst. Es gab aber auch einen kleinen externen Anstoß: Nachdem die TV-Dokumentation „Das Schweigen der Quandts“ 2007 ausgestrahlt wurde, erschien in der „Financial Times Deutschland“ der Artikel „Das Schweigen der Anderen“. Dort wurden die Oetkers auch genannt. Das war der Zeitpunkt, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, bevor andere es tun.
Hatten Sie Befürchtungen wegen der Ergebnisse?
Nein, die Ergebnisse waren gut einzuschätzen. Es gab 2004 eine Studie von „Zeit“-Wirtschaftsredakteur Rüdiger Jungbluth. Daraus ergab sich schon, dass nichts völlig Überraschendes zu erwarten war. Oetker war zur NS-Zeit ein kleiner Fisch. Daran erinnerte auch Professor Werner Plumpe von der Goethe-Universität bei der Veröffentlichung der aktuellen Studie. Wenn man das Agieren Oetkers auf wissenschaftlicher Seite in Relation zu anderen Unternehmen setzt, merkt man, dass Dr. Oetker im Dritten Reich verhältnismäßig unwichtig war.
Rudolf-August Oetker, Enkel des Unternehmensgründers, hatte sich Zeit seines Lebens gegen eine Aufarbeitung der NS-Zeit gewehrt. Wie sind Sie damit umgegangen?
Das war vor meiner Zeit. Ich bin erst seit Oktober 2007 ins Unternehmen gekommen und war von Anfang an dabei, als der Beschluss von der Familie gefasst wurde.
Und Ihr Vorgänger?
Der musste sich daran halten, wie auch alle Angehörigen der Familie. Nicht zu kommunizieren war typisch für die Mitglieder der Generation, der Rudolf August Oetker angehörte.
Und wie wären Sie damit umgegangen?
Ich hätte es mit Sicherheit angesprochen. Bevor mein Vorgänger in Pension ging, haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir beide der Familie zur Offenheit raten möchten. Offenheit ist hier das beste Mittel. Die Inhaberfamilie hat von vornherein gesagt, wenn man sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, muss man auch dazu stehen. Es gibt Unternehmen, bei denen das anders lief. Sie haben ihre Geschichte erforschen lassen und dann die Ergebnisse nicht veröffentlicht.
Dr. Oetker hatte den Forschern vertraglich zugesichert, dass die Studie veröffentlicht wird. Inwieweit beeinflussen die Ergebnisse nun die Marke Oetker?
Wir haben die Print- und Online-Berichterstattung beobachtet und haben auch sehr viele Zuschriften von Bekannten und von Verbrauchern bekommen. Circa 90 Prozent finden, die Studie passe zur Marke Dr. Oetker: eine Marke, die offen und ehrlich ist. Das hat die Marke also gestärkt. Die Publikation an sich ist aber schon längst wieder vergessen. Einen direkten Einfluss auf die Marke haben wir nicht festgestellt. Das Buch erscheint höchstens noch auf Sachbücher-Listen für Weihnachtsgeschenke.
Und wie haben die Mitarbeiter auf die Veröffentlichung reagiert?
Ich habe die Mitarbeiter häufig darauf angesprochen. Zur Veröffentlichung der Studienergebnisse haben wir ein Statement der Familie ins Intranet gestellt und auf „Seite 3“ unserer Mitarbeiterzeitung einen Artikel veröffentlicht. Das ist sehr gut angekommen. Wo ich konnte, habe ich nachgefragt, auch bei den Geschäftsführern im Ausland. Dort wurden auch alle Mitarbeiter informiert.
Lassen sich die gewonnenen Fakten mit der Kommunikationsstrategie vereinbaren?
Eine Grundvoraussetzung der Studie war, dass wir sie nie für PR-Zwecke nutzen wollten. Der einzige Nutzen war, sich der Geschichte zu stellen und das zu kommunizieren.
Es gibt einige schwarze Schafe unter den Historikern, die in Forscherkreisen für unwissenschaftliches Arbeiten kritisiert werden. Wie haben Sie das passende Forscherteam gefunden?
Ich bin selbst Historiker und habe einen renommierten Forscher gefragt, an wen ich mich wenden kann. Dann haben wir mit mehreren Historikern gesprochen und uns für Professor Andreas Wirsching entschieden.
Es ist also ratsam, sich von einem Berater für die Suche nach den geeigneten Forschern helfen zu lassen?
Wenn man gar nicht im Thema steckt, ist das schon sehr hilfreich. Man kann sich aber auch an das Institut für Zeitgeschichte wenden und um Kontakte bitten. Man findet auch viel, wenn man sich im Internet über die Forscher informiert.
Und nun konkret zum Ablauf: Wie sahen die drei Jahre Forschungsarbeit aus?
Die Forscher hatten völlig freie Hand und haben in Anwesenheit unseres Archivars in unserem Archiv die Bestände durchgearbeitet und zum Teil auch neu katalogisiert. Sie waren auch häufig europaweit auf Archivreise und haben uns regelmäßig über den Zwischenstand informiert. Es gab außerdem eine sechsmonatige Probephase, in der recherchiert wurde, ob die Quellen für eine Studie überhaupt ausreichend sind. Der Schwerpunkt des Projekts lag definitiv bei den Experten. Wir verweisen deshalb auch immer an das Forscherteam bei Anfragen.
Gibt es im Nachhinein etwas, was sie anders machen würden?
Rückblickend würde ich nichts anders machen. Es lief alles wie geplant. Es wurde natürlich viel diskutiert über Funde, aber das hielt sich in Grenzen, da die Familie die Aufarbeitung unterstützte. Wichtig ist, dass es einen Konsens bei den Inhabern gibt.
Ein Tipp zum Schluss: Was raten Sie Kommunikationschefs, die eine Unternehmensstudie planen?
Sie sollten die Ausgangssituation analysiert haben, sich fragen „wo stehe ich?“. Dann die Unternehmerfamilie beziehungsweise die Unternehmensleitung mit dem Projekt vertraut machen und die Notwendigkeit erklären. Und ausschließlich anerkannte, integre Wissenschaftlern beauftragen. Außerdem die Voraussetzung schaffen, dass das Unternehmen das Projekt komplett unterstützen kann. Das Budget muss natürlich gestellt werden. Und man muss darauf vorbereitet sein, dass auch unangenehme Dinge zutage treten können.