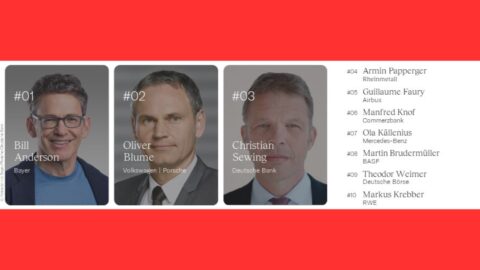Kammerflimmern! Tritt es ein, zählt jede Sekunde. Der Patient ist in Lebensgefahr, die Herzlinie im EKG verläuft hektisch zackig. Defibrillator. Stromimpuls. Schock. EKG? Wieder normal, wenn es gutgeht.
Doch was, wenn der Patient das Krankenhaus selbst ist? Wenn viele Vitalzeichen auf einen nahenden Exitus – mit anderen Worten: die Insolvenz – hindeuten? Und wenn leider kein Defibrillator helfen kann? Dann muss ein Reset erfolgen, quasi ein Neuanfang vor dem Ende. So war das, als ich 2013 als Leiter der Unternehmenskommunikation in das Klinikum Dortmund kam. Zur gleichen Zeit begann dort ein neuer Vorsitzender der Geschäftsführung seine Arbeit. Eine Übergabe gab es nicht, weder bei ihm noch bei mir.
Zugegeben, uns beiden war der dramatische Zustand des Patienten namens Klinikum nicht in allen Teilen bekannt. Doch wir ahnten: Ein einzelner „Stromschock“ würde nicht helfen.
Über zehn Jahre hinweg war eines der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland in massive finanzielle Schieflage geraten. Kein Einzelfall in einer Branche, die wie kaum eine zweite nahezu planwirtschaftlich durch die Politik gesteuert wird. Zwar brachte es das Haus mit 4.000 Mitarbeitern und 250.000 Patienten pro Jahr auf einen Umsatz von 350 Millionen Euro. Doch gleichzeitig drückten Schulden im dreistelligen Millionenbereich.
Der Investitionsstau war allerorten spürbar. Die Medien schrieben bereits ihren Abgesang auf das Haus, private Investoren kreisten förmlich wie Geier. Einige Hundert Arbeitsplätze standen auf dem Spiel.
Es gab auch Gutes in der Misere
Zur gleichen Zeit konsolidierte sich der Medienmarkt im Ruhrgebiet. Die großen Verlage teilten die Region unter sich auf. In Dortmund gaben somit zwei von drei Zeitungsredaktionen faktisch auf. Auch ein beliebtes TV-Format wurde damals eingestellt: die „Lokalzeitklinik“ als Gesundheitsthemen-Fenster in der WDR-Lokalzeit.
Dabei gab es so viel zu berichten. Das Klinikum Dortmund zählte selbst in seinen finanziell schwersten Zeiten medizinisch zu den besten Häusern in Deutschland. Das bestätigen regelmäßig unabhängige Fachgesellschaften.
Das Gute in der Misere: Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Rudolf Mintrop, vertraute mir, er ließ mich machen. Während er 2013 und 2014 vor allem die Banken von einer günstigen wirtschaftlichen Prognose für das Haus überzeugen musste und dafür alles in Bewegung setzte, war es an mir, dem Haus und seinen Mitarbeitern öffentlich ein neues Antlitz, ja: Selbstbewusstsein, zu geben.
Ich war damals alleine in der Unternehmenskommunikation, deren Budget zudem um rund drei Viertel gekürzt worden war. Mein Ziel konnte also nur lauten: Mach 4.000 Mitarbeiter zu Öffentlichkeitsarbeitern, zu Fürsprechern des Hauses! Und lege alles den Medien so zurecht, dass sie nur noch anbeißen müssen.
„Ich war damals alleine in der Unternehmenskommunikation, deren Budget zudem um rund drei Viertel gekürzt worden war. Mein Ziel konnte also nur lauten: Mach 4.000 Mitarbeiter zu Öffentlichkeitsarbeitern!“
Storytelling plus Erklärservice
Zu den Veränderungen in der Unternehmenskommunikation gehörten eher quantitative, wie eine Differenzierung der Medienansprache (von zwei auf 18 Presseverteiler) und eine Steigerung der Anzahl an Pressemeldungen (von 50 auf 150 pro Jahr). Fünfmal mehr Meldungen konnten deshalb im besten Sinne als „Storytelling“ gewertet werden.
Dazu gehörte aber auch eine qualitative Veränderung der Botschaften – hin nämlich zu voll ausrecherchierten „Geschichten“, die von Zeitungen eins zu eins ins Blatt gehoben werden konnten. Bei inhaltlich zum Teil sehr komplexen Medizinthemen wird dieser Service von Redaktionen erfahrungsgemäß sehr gern angenommen.
Doch mehr noch: Das Klinikum setzte seit 2013 wie kein zweites Krankenhaus in Deutschland auf Präsenz in den sozialen Medien. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, ja sogar Snapchat, Whatsapp und Jodel werden seither bedient. Was die sozialen Medien können, schafft kein schwarzes Brett im Haus: Identität nämlich – und gleichzeitig den Mitarbeitern die Möglichkeit, Stolz-mach-News mit den jeweils eigenen Freunden zu teilen.
Natürlich galt es dabei stets, kreativ aufzufallen. Aus Kostengründen verzichteten wir auf externe Unterstützung durch eine Agentur. Für die sozialen Kanäle entstanden daher in Eigenentwicklung unter anderem ein Youtube-Video, in dem eine Krankenschwester einen Spagat auf zwei rollenden Betten machte (als Werbefilm für das Recruiting von Berufsfreiwilligendienstlern), sowie ein Film über OP-Geräusche, die dank des Orchesterzentrums NRW zu einer percussionartigen Musik wurden (als Recruiting-Werbung für OP-Personal). Am bekanntesten jedoch ist unsere Live-Sprechstunde auf Facebook und Instagram mit Ärzten unseres Hauses. Mit bislang mehr als 60 Folgen hat sie längst ein Millionenpublikum erreicht.
Sich immer wieder neu erfinden
Die Wende hin zum Guten? Ende 2014 war sie geschafft. Bereits zu diesem Zeitpunkt war die Klinikum Dortmund gGmbH erstmals aus eigener Kraft wieder rentabel geworden. Die Gründe? Ein unverhoffter Patientenzuwachs (plus zehn Prozent) trotz gleichbleibender Kapazitäten – und gezielte PR. Der Patient Krankenhaus war also vorerst überm Berg. Er hat seitdem ausschließlich schwarze Zahlen in der Bilanz. Und in der Kommunikation werde ich inzwischen von zwei Kollegen, einem Volontär sowie regelmäßig von Praktikanten unterstützt.
Doch wie wird es kommunikativ weitergehen? PR im Krankenhaus muss sich ständig neu erfinden. Aktuell ist das Thema Recruiting das wichtigste. Dafür haben wir – erneut eine Eigenentwicklung von der Idee bis zur Programmierung – unter anderem die App „Jinder – der Job-Finder“ entwickelt. Parallel arbeiten wir daran, die Megatrends „Virtuelle Realität“ und „Augmentierte Realität“ künftig in unsere Patientenkommunikation einzubinden.
Es geht also nie zu Ende. Und das ist gut.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe ALLES AUF ANFANG. Das Heft können Sie hier bestellen.