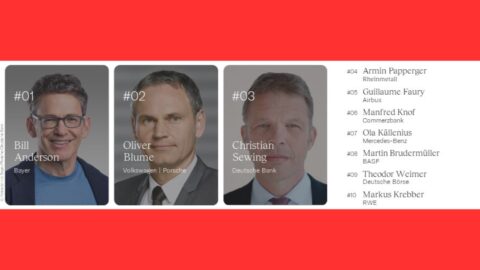Herr Hill, das Titelthema dieser pressesprecher-Ausgabe ist „Interkulturelle Kommunikation“. Was verstehen Sie unter diesem Begriff?
„Interkulturelle Kommunikation“ beziehungsweise „interkulturelle Kompetenz“ heißt für mich, bereit zu sein, sich erfolgreich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Dafür muss man eine andere Sprache nicht perfekt beherrschen. Es geht vielmehr darum, offen und tolerant zu sein. Mehr über andere Kulturen lernen, und auch die eigene repräsentieren zu wollen.
Fehlt unserer Gesellschaft die interkulturelle Kompetenz beziehungsweise die Fähigkeit, interkulturell zu kommunizieren?
Denkt man an die erste Generation der Bürger mit Migrationshintergrund, die im Deutschland der 1950er Jahren vom Rest der Gesellschaft noch stark abgeschottet lebte, ist man heute ein großes Stück weiter. Die nachfolgenden Generationen haben erkannt, dass sie von den verschiedenen kulturellen Einflüssen auch profitieren können. Aber an der interkulturellen Kompetenz insgesamt ließe sich mit Sicherheit noch einiges verbessern.
Und woran müsste Ihrer Meinung nach noch gearbeitet werden?
Für generell falsch halte ich beispielsweise, dass man sich noch immer in einem fremden Land niederlassen kann, ohne sich mit dessen Sprache oder Kultur auseinanderzusetzen. So kann man nicht mehr Verständnis für einander entwickeln und die Gesellschaft läuft Gefahr, dass Stereotype sich verfestigen. Aber es darf keine „kulturelle Einbahnstraße“ sein, es ist auch wichtig, dass die Bevölkerung des Aufnahmelands bereit ist, sich über die „mitgebrachte“ Kultur zu informieren. Ich denke an eine Gedichtzeile von meinem Lieblingsdichter, dem Perser Rumi aus dem 13. Jahrhundert: „Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I’ll meet you there.“
Aber sind solche Stereotype nicht auch hilfreich?
Manchmal schon, mit Stereotypen vereinfachen wir unsere Welt. Es wird nur schwierig, wenn diese Bilder zu Hassbildern verzerrt werden und sich festsetzen. Wir haben das nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York im September 2001 erlebt. Ich habe damals in Schottland mit vielen muslimischen Studenten zusammengearbeitet und mitbekommen, wie missverstanden sie sich fühlten. Für mich war das ein Grund, um im relativ hohen Alter noch ein islamwissenschaftliches Studium zu beginnen. Ich wollte versuchen, diese Stereotype zu identifizieren und durch meine eigene Erfahrung und Wissen zu dekonstruieren, mir also ein realistisches Bild verschaffen. Ich kann jedem nur raten, sich mit Stereotypen kritisch auseinanderzusetzen.
Viele Organisationen, die ihre Mitarbeiter länger beruflich ins Ausland schicken, bieten vorbereitende Seminare an. Darin hat der Umgang mit stereotypen Bildern sicher auch seinen Platz. Was halten Sie von solchen interkulturellen Trainings?
Ich halte diese Seminare für ungeheuer wichtig. Selbst meine ältere Tochter hat ein interkulturelles Training durchlaufen, bevor sie für ein Work & Travel-Jahr nach Peru ging. Interkulturelle Trainings können verhindern, dass die Mitarbeiter an ihrem neuen Einsatzort einen „Kulturschock“ bekommen, oder zumindest manche Krisensituationen durch Strategien mildern oder entschärfen. Sind die Mitarbeiter für einen Einsatz im Ausland nicht gut vorbereitet, fühlen sie sich oft nicht wohl und müssen womöglich frühzeitig wieder abgezogen werden. Das wird für Unternehmen dann schnell teuer. Es lohnt sich also auch aus finanzieller Sicht, in die interkulturellen Kompetenzen von Mitarbeitern zu investieren.
Konstruieren wir doch ein Beispiel: Drei Manager sollen über den Vertrag eines gemeinsamen Projekts verhandeln. Der eine kommt aus Berlin, der andere aus den USA und der Dritte aus China. Welche Fettnäpfchen könnte es bei dem Trio geben?
Ein Problem könnte sicherlich der Zeitfaktor werden. Im Gegensatz zu Amerikanern und Deutschen weisen Chinesen dem Gespräch abseits der Geschäftsverhandlungen größere Bedeutung zu. Erst letztens habe ich auf einer Reise dort wieder erlebt, wie bedeutend es ist, sich Zeit für Eröffnungsfloskeln oder ein gemeinsames Essen zu nehmen. Verhandlungen dauern dort länger. Das klingt erst einmal banal, aber es wird immer wieder gerne vergessen. Gerade in der asiatischen und arabischen Welt sollte man die persönliche Beziehung unbedingt pflegen. Man zollt seinen Geschäftspartnern so Respekt, bekommt eine ganz andere Vertrauensbasis und kann auch in schwierigen Situationen besser sein Gesicht wahren.
Wenn es bei interkultureller Kompetenz in der Wirtschaft vor allem darum geht, Verständnis für die Geschäftspartner und ihr Umfeld zu entwickeln, dann müssten Unternehmen doch eigentlich jeden Mitarbeiter schulen, oder?
Viele Manager sehen interkulturelles Wissen heutzutage eher als Luxus. Aber letztlich ist es fast schon ein Grundbedürfnis in der heutigen Gesellschaft. Jeder kann und sollte seine interkulturellen Fähigkeiten ausbauen. Der Umgang mit anderen Kulturen ist vergleichbar mit der Jobsuche. Bewerben Sie sich bei einem Ihnen unbekannten Unternehmen, informieren Sie sich im Vorfeld auch über die Umgebung, die Menschen und die dortigen Gepflogenheiten. Auf diese Weise können Sie sich besser auf verschiedene Situationen einstellen, ein Gefühl für die andere Kultur entwickeln und Missverständnissen vorbeugen. Und das ist jetzt nur auf das Unternehmensumfeld heruntergebrochen, doch es zeigt: Man muss, um vom interkulturellen Training zu profitieren, nicht unbedingt ins Ausland gehen. Wir leben mittlerweile in einer multikulturellen Gesellschaft hier vor Ort an unserem Arbeitsplatz. Das ist aus meiner Sicht meistens eine Bereicherung.
Wie können Unternehmen den Austausch zwischen den Kulturen fördern?
Sie könnten Programme am Arbeitsplatz anbieten – sei es Sport oder andere Aktivitäten, bei denen sich Mitarbeiter begegnen und austauschen können. Es versteht sich, dass diese Programme freiwillig sind. Zudem hilft es, Probleme offen anzusprechen und nicht erst verhärtete Fronten entstehen zu lassen. Vielleicht ist der Grund des Problems allein auf unterschiedliche Auffassungen zweier Kulturen zurückzuführen. In Großbritannien beispielsweise fühlen sich muslimische Mitarbeiter manchmal ausgeschlossen, wenn sie nicht in den Pub gehen. Der freitägliche Pub-Besuch hat in Großbritannien eine lange Tradition, dort wird viel über die Arbeit gesprochen. Was würde dagegen sprechen,wenn nicht muslimische Mitarbeiter vielleicht einmal das Jummagebet in der Moschee vor Ort erleben würden? Viele deutsche Mitglieder des Freundeskreises Idstein/Şile nahmen zum Beispiel während Ramadan an einem Iftar-Essen in der Moschee teil.
Sie selbst sind in Edinburgh aufgewachsen und lehren jetzt an der Fresenius Hochschule im hessischen Idstein. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, als Sie nach Deutschland kamen?
Bei mir waren die Voraussetzungen etwas anders. Ich habe Germanistik in Schottland studiert und war bis zu einem gewissen Maß der deutschen Sprache mächtig, aber dann kam ich nach München. Und in Bayern habe ich nichts mehr verstanden. Das war schon frustrierend. Aber mir haben viele Menschen geholfen, wofür ich ihnen heute noch dankbar bin. Ich habe sogar später meine Doktorarbeit über den bayerischen Komiker Karl Valentin geschrieben. Auch wenn ich zu Beginn sagte, dass man eine andere Sprache nicht perfekt beherrschen muss, um eine andere Kultur kennenzulernen, so sind ein paar Vokabeln der andere Sprache doch hilfreich. Allein, dass man sich bemüht, die Sprache des anderen zu lernen, wird meist als herzliche Geste aufgenommen.
Zur Person:

Murray Hill ist Professor für interkulturelle Kommunikation an der Fresenius Hochschule in Idstein. Ursprünglich kommt er aus Edinburgh/Schottland. Nach langjähriger Tätigkeit als Germanist an einer schottischen Universität lebt er seit 2009 wieder in Deutschland. Hier studierte und forschte er schon am Anfang seiner Laufbahn.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Interkulturelle Kommunikation. Das Heft können Sie hier bestellen.