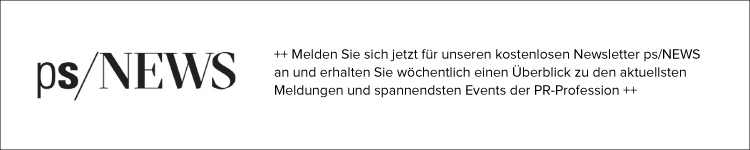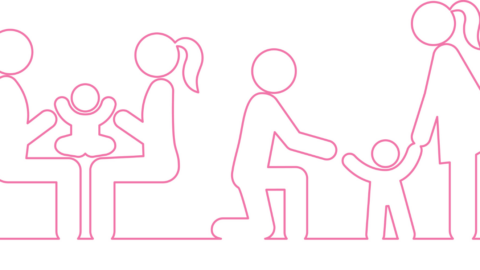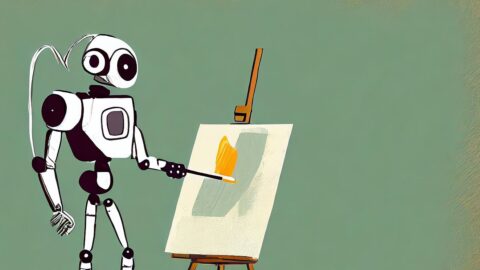Sie sind der Albtraum eines jeden Personalers: Scheinbewerber, sogenannte „AGG-Hopper“ (benannt nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz), bewerben sich auf freie Stellen. Allerdings nicht um eingestellt, sondern um unter diskriminierenden Umständen abgelehnt zu werden. Im Anschluss verklagen sie das jeweilige Unternehmen auf Zahlung von Schadenersatz oder Entschädigung. Es gibt bereits Scheinbewerber, die diese Masche in derart großem Stil betreiben, dass sie bundesweit in Personalabteilungen zweifelhaften Ruhm erlangt haben.
– Anzeige –
AGG-Hopper suchen gezielt nach unvollständigen oder unklaren Formulierungen in Stellenausschreibungen, die auf eine Verletzung des Benachteiligungsverbots hindeuten. So weisen Ausdrücke wie „junges dynamisches Team“ oder „Berufsanfänger“ auf eine Diskriminierung hin und können Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche auslösen.
Die Unternehmen sind in den vergangenen Jahren wachsamer geworden und darauf bedacht, Stellenausschreibungen diskriminierungsfrei zu formulieren.
Im Hinblick auf das Diskriminierungsmerkmal „Geschlecht“ hat es sich in der Praxis zur Gewohnheit entwickelt, offene Stellen mit dem Zusatz „m/w“ zu versehen, um deutlich zu machen, dass sich die Ausschreibung sowohl an Männer als auch Frauen richtet. Mit der Anerkennung des dritten Geschlechts durch das Bundesverfassungsgericht im Oktober 2017 könnten AGG-Klagen nun eine Renaissance erfahren: Auch Personen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, müssen zukünftig von Stellenanzeigen angesprochen werden.
Geschlechtsneutrale Stellenausschreibungen
Eine Möglichkeit für Unternehmen wäre es, ausgeschriebene Tätigkeiten unter geschlechtsneutrale Oberbegriffe zu fassen, wie zum Beispiel „Pflegekraft“ oder „Betreuungspersonal“. Jedoch lässt sich nicht für jede Tätigkeit ein solcher Oberbegriff finden. Daher ist es ratsam, die ausgeschriebene Stelle durch den Zusatz „m/w/d“ zu ergänzen. Wer auf Nummer sicher gehen und alle möglichen Diskriminierungsmerkmale ausschließen möchte, schreibt am besten „m/w/divers“.
Derzeit scheint es die beste Variante zu sein. Sie folgt der Bezeichnung im aktuellen Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Neuregelung des Personenstandsgesetzes vom 15. August 2018. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber in seiner Entscheidung eine Frist bis 31. Dezember 2018 gegeben, das Personenstandsrecht zu ändern.
Der Regierungsentwurf sieht vor, dass neben „männlich“ und „weiblich“ auch „divers“ ins Geburtenregister eingetragen werden kann. Allerdings kann sich der Entwurf noch ändern.
Abkürzungen wie das mittlerweile in Stellenanzeigen auftauchende „m/w/x“ sind risikobehaftet. Zwar wird auch so deutlich, dass neben männlich und weiblich noch weitere Geschlechteridentitäten von der Ausschreibung erfasst sind. Allerdings dürfte nicht jedem klar sein, was unter „x“ zu verstehen ist.
Schwierige Beweisführung für verklagte Unternehmen
Warum ist es wichtig, bei der Formulierung von Stellenanzeigen so sorgfältig vorzugehen?
Das AGG enthält das Gebot der diskriminierungsfreien Stellenausschreibung. Für den Fall, dass ein Arbeitgeber diesem Gebot nicht nachkommt, bietet das AGG Bewerbern die Möglichkeit, Schadenersatz und Entschädigung zu verlangen. Die Bewerber müssen lediglich die Umstände vorbringen, aus denen eine Benachteiligung resultieren könnte. Für eine Person, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnet, dürfte die Formulierung „m/w“ zur Begründung der Vermutung einer Diskriminierung ausreichen.
Es ist Aufgabe des Unternehmens zu beweisen, dass das Geschlecht im Bewerbungsprozess keinerlei Rolle gespielt hat. Dieser (Negativ-)Beweis wird in den meisten Fällen schwierig bis unmöglich zu erbringen sein. Im schlimmsten Fall muss das Unternehmen Schadensersatz und Entschädigung an den abgelehnten Bewerber zahlen. Das bedeutet, dass materielle Schäden (wie die Bewerbungskosten) zu ersetzen sind und eine „angemessene“ Entschädigung zu leisten ist. Zudem ist für den Anspruch auf Entschädigung kein Verschulden des Arbeitgebers notwendig.
Aufgrund denkbarer Klagen sollten Bewerbungsunterlagen von abgelehnten Bewerbern zudem mindestens sechs Monate, am besten sogar zwölf Monate nach der Absage aufbewahrt werden.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KONKURRENZ. Das Heft können Sie hier bestellen.