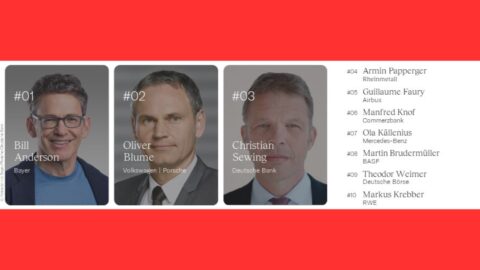Als Experte für Krisen- und Litigation-PR habe er sich die Fähigkeit angeeignet, Kunden zu helfen, „um die Ecke zu sehen“, damit sie Krisen vermeiden können, sagt Alan Hilburg beim Treffen mit dem pressesprecher in Berlin. Das Credo des Krisen-PR-Veteranen lautet: „Jede Krise ist bedauerlich, aber eine Gelegenheit, Charakter zu zeigen. Zu zeigen, wie man wertegetriebene Entscheidungen trifft.“ Stelle man sich den zeitlichen Verlauf einer Krise als einen Bogen vor, so sei die wichtigste Stelle darauf links unten: „die Vorbeugung-und-Vermeidung-Stelle“.
Mister Hilburg, Sie sagen, in diese Phase zu investieren, sei die beste Entscheidung, die ein Unternehmen tätigen kann. Handeln Sie also im Grunde wie eine Art Versicherung?
Alan Hilburg: Das kann man so ausdrücken. Und warum hat man eine Versicherung? Nicht weil man sie möchte, sondern weil man sie braucht. In einer Krise geht es nie um Kommunikation allein, sondern immer darum, das Business am Laufen zu halten. Kein CEO würde je eingestellt werden, weil er in einer Krise gut kommuniziert – sondern weil er gut managen und Probleme lösen kann. Ich habe in meiner Karriere mit mehr als 200 CEOs zu tun gehabt. Jeder einzelne von ihnen hat es bestätigt. Es besteht also ein Unterschied zwischen Krisenkommunikation und Krisenmanagement oder auch Krisenleadership.
Erklären Sie das bitte genauer.
Vom ökonomischen Standpunkt aus gesehen ist Krisenprävention deutlich günstiger als die Entschärfung einer Krise, die bereits da ist. Nicht nur, was die unmittelbaren Kosten betrifft. Nicht Geld ist es, was ein Unternehmen in einer Krise verlieren kann. Sondern, viel wichtiger: Vertrauen. Erst kürzlich auf dem Weltwirtschaftsforum hieß es wieder, Misstrauen verkörpere die größte Krise der vergangenen sieben Jahre.
Vertrauen und Reputation hängen bekanntlich eng zusammen.
Richtig. Aber während Reputation eine Sache der Kommunikation ist, ist Vertrauen eine Sache des Business. Das ist übrigens keine semantische Frage, sondern Realität (lacht). Stellen Sie sich – metaphorisch gesehen − Vertrauen als einen Baum vor und Reputation als Schatten. An sonnigen Tagen sieht man den Schatten. An bewölkten, regnerischen oder stürmischen Tagen jedoch nicht. Dann ist nur der Baum zu sehen. Nur er ist real. Alles, was Vertrauen bedroht, bedroht letztlich auch das Geschäft. Ich bezeichne uns daher gern als „Vertrauensarchitekten“.
Würden Sie sagen, die Zahl der Krisen weltweit hat in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen? Oder ist die Schwelle dessen, was wir heute als „Krise“ bezeichnen, lediglich gesunken?
Nein, die Zahl hat tatsächlich zugenommen – und zwar durch den Einfluss von Social Media. Wenn mich vor 20 Jahren ein Klient angerufen hat, wusste ich: Wir haben nun eine Stunde Zeit. Das war eine Art Sicherheitszone. Und heute? Heute haben wir drei Sekunden. In der „VUCA“-Welt (Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, Anm.d.Red.) haben die sozialen Netzwerke für mehr Volatilität, mehr Unsicherheit, mehr Komplexität, mehr Mehrdeutigkeit gesorgt.
Ist es oftmals schwierig, Klienten davon zu überzeugen, in Krisenprävention zu investieren statt in Krisenkommunikation – also erst dann, wenn die Krise bereits da ist?
Ja. Und die fundamentale Frage dabei lautet: Warum ist das so? Ich bitte CEOs oft: „Rechnen Sie mir mal vor, wie hoch die Kosten sind, wenn Ihre Stakeholder − Ihre Mitarbeiter, Shareholder, Kunden, die Medien und die Politik − das Vertrauen verlieren! Wenn Sie das schaffen, wissen Sie, was es kostet, nicht vorbereitet zu sein.“
Und, wie viele können es?
Keiner (lächelt). Dabei ist es finanziell gesehen ebenso verantwortungslos, keinen Krisenplan zu haben wie keine Versicherungspolicen zu haben. Also keinen Plan, der jeden Aspekt des Business einschließt. Als Berater versuchen wir, eine Art neurowissenschaftliche Perspektive einzunehmen. Wir fragen uns: Was passiert chemisch gesehen in unserem Gehirn? Wann kämpfen wir? In welchen Momenten fliehen wir? Inmitten einer Krise Businessentscheidungen zu treffen, verlangt eine andere Herangehensweise und andere Fähigkeiten, als es alltägliche Entscheidungen tun.
Sie sind international tätig. Welche Unterschiede haben Sie im Krisenmanagement in verschiedenen Teilen der Welt festgestellt?
Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Wege, mit Krisen umzugehen. In Asien zum Beispiel ist das Wahren des Gesichts enorm wichtig. Dort geben die Menschen noch weniger gern zu, wenn es eine Krise gibt. Gerät diese jedoch außer Kontrolle, macht es die Sache nur noch schlimmer. Viel hängt aber auch von der Kultur innerhalb eines Unternehmens ab.
Wie meinen Sie das?
Ich verwende gern das Bild vom Eisberg. 96 Prozent von ihm liegen unterhalb der Meeresoberfläche, nur vier Prozent sichtbar darüber. Diese vier Prozent stehen für den Anteil der Probleme, derer sich Führungskräfte bewusst sind. Ganz unten aber, am Grunde des Eisbergs, weiß die Belegschaft zu hundert Prozent um die Probleme, denen sich ihre Firma gegenübersieht. Die Frage ist nun: Herrscht eine Kultur des „speaking truth to power“, in der die da unten jene da oben warnen dürfen und gehört werden? Ein Beispiel, wo dies nicht der Fall gewesen ist, sind BP und die Ölkatastrophe 2010 im Golf von Mexiko.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe SPIELEN. Das Heft können Sie hier bestellen.