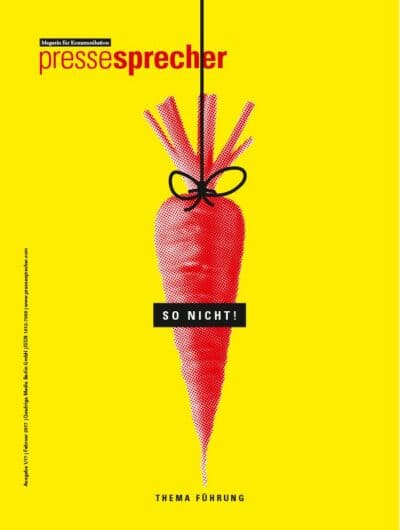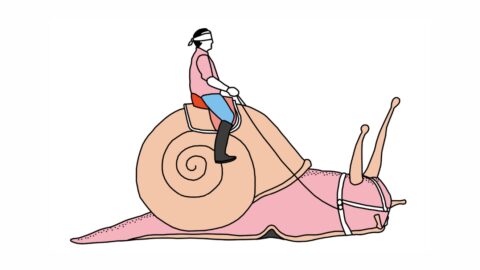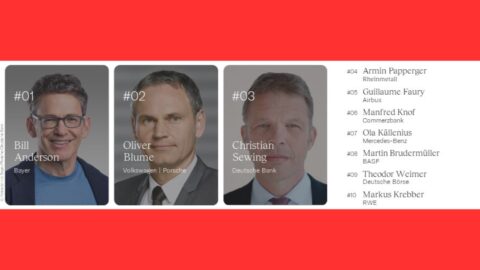Herr Rogl, Steuerhinterziehung, Betrug, rechtsextreme Unterwanderung, ein ominöser Flugzeugabsturz in Slowenien, bei dem unter anderem zwei Ihrer Chefs, Thomas Wagner und Oliver Schilling, ums Leben kamen und ein Koffer voller Schwarzgeld gefunden wurde. Kein leichter Job als Pressesprecher von Unister, den Sie da hatten.
Dirk Rogl: Da haben wir schon die ersten Fehler: Es wurde nach dem Flugzeugabsturz nie ein Koffer voller Schwarzgeld gefunden. Es waren zehn Scheine im Wert von zehntausend schweizer Franken. Aber just solche Gerüchte haben sich in der Öffentlichkeit eingeprägt und konnten wegen der Massivität nicht mehr korrigiert werden.
Was war das denn sonst für Geld?
Gute Frage. Die müssen die Ermittlungsbehörden klären.
Wie haben Sie von dem Absturz erfahren?
Ich saß im Zug nach Hamburg auf dem Weg in den Urlaub, als der Anruf einer großen Boulevardzeitung kam. Ich stieg an der nächsten Station aus und nahm direkt den Gegenzug zurück nach Leipzig.
Sie erfuhren von der finalen Krise also weder von Kollegen noch von der Polizei, sondern von den Medien?
Ja, und es war schon dort erkennbar, wie die Medien hier gut genutzt oder instrumentalisiert wurden.
Und haben dann noch im Zug mit der Krisenkommunikation begonnen?
Es gab schnell aufkommende Gerüchte und Vorwürfe, da war höchste Eile geboten. Dabei waren die Telekommunikationsnetze auf ostdeutschen Bahnstrecken eine echte Herausforderung … Wir haben den Abend dann genutzt für erste interne Weichenstellungen und beschlossen im Rahmen der Möglichkeiten erste Sprachregelungen.
Wie lief das intern?
Es half, dass ich Teil der erweiterten Führung von Unister war. Das ermöglichte kurze Wege. Zunächst war unser Wissensstand gering, es ging erst einmal um Aufklärung. Wir haben dann die Fragen kanalisiert, interne Entscheidungen gefällt und ein erstes Statement entworfen, bei dem die Trauer im Vordergrund stand.
Dirk Rogl im Interview mit pressesprecher-Chefredakteurin Hilkka Zebothsen in der Hamburger Rehbar (c) Oliver Fantitsch
Sie waren an diesem 14. Juli schon ein paar Jahre im Unternehmen, aber erst wenige Wochen zuvor auf die Position des Chief Communication Officers der Holding aufgerückt. Haben Sie zu diesem Zeitpunkt geahnt, dass Ihre Tage im Unternehmen gezählt sind?
Natürlich nicht. Es war nicht absehbar, dass es so dramatisch endete. Das war ein Worst-Case-Szenario voller tragischer Zufälle und Unberechenbarkeiten.
Bleiben wir bei der Akutphase. Sie denken, „das kann nicht sein“, aber müssen nach dem Absturz den Medien irgendetwas sagen, um Zeit zu gewinnen.
Wir hatten ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Medien. Die schafften aber durch ihre Veröffentlichungen natürlich Fakten. Sehr schnell stiegen Agenturen und Portale darauf ein, und die Nachricht selbst war nicht mehr versteckbar. Dafür gab es auch keinen Grund.
Was haben Sie dann konkret getan?
Das alles war abends. Interne Kommunikation war schwer ohne Fakten, zu diesem Zeitpunkt war ja noch nicht einmal der Tod von Thomas Wagner und Oliver Schilling offiziell bestätigt. Wir haben im erweiterten Führungskreis gesprochen und externen Rat eingeholt. Wir wollten nicht überstürzt handeln. Wichtig war dann das erste abendliche Statement, das von Beileid geprägt war, sowie die Traueranzeigen in verschiedenen Medien für den nahen Samstag.
Wer gehörte zu dem engen Kreis?
Der Stab, der bis zuletzt zusammenblieb, bestand aus der Führungsmannschaft, den Verantwortlichen für die Portale, Abteilungsleitern, Direktoren.
Mussten Sie lange diskutieren, wer nach außen spricht, wer das Gesicht der Krise werden würde?
Nein, das musste nicht diskutiert werden. Es war klar, das bin ich. Wir konnten ja keinen Allein-Geschäftsführer mehr sprechen lassen, denn der war tot. Darum griffen bei uns viele Regeln klassischer Krisenkommunikation nicht: Wir hatten mit Thomas Wagner eine Geschäftsführung, die in vielen Teilen unsichtbar sein wollte, die kommunikativ nicht stark geprägt war. Und die sich aufgrund der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden nicht zu allen relevanten Punkten öffentlich äußern konnte. Andere Gesichter außer mir zu finden, war immer eine Herausforderung, nicht nur in diesem Sommer. Das habe ich bedauert.
Sie kannten das Spiel: Bevor Sie zu Unister gingen, arbeiteten Sie auf der „anderen Seite“, bei den Medien.
Ja, ich war seit Dezember 2014 bei Unister, aber davor 15 Jahre beim führenden Tourismusfachmagazin, der FVW. Und ich nehme für mich in Anspruch, der erste kritische Verfolger von Unister und Thomas Wagner gewesen zu sein. In einem jungen, dynamischen und schnell wachsenden Unternehmen läuft nicht immer alles ideal. Fehlertolereranz gilt in anderen Start-ups als smart und sexy. Thomas Wagner ging bewusst Fehler ein, und ich schrieb früher viel über diese Fehler.
Also kaufte er seinen größten Gegner als Pressesprecher ein?
Ich war nicht sein größter Gegner. Aber ich war sehr detailversessen.
Wurden Sie deshalb eingestellt?
Davon gehe ich aus.
Womit hat er Sie dann gekriegt?
Mich hat die Herausforderung gereizt, dieses Ding umzudrehen. 2012 änderte sich die Darstellung von Unister-Themen massiv. Spätestens seit den auch für mich schwer nachzuvollziehenden Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden gegen ihn baute sich ein Druck auf, der schwer auflösbar war. Das können sie nur mit guten Argumenten und dem langfristigen Aufbau von Vertrauen heilen. Das haben wir in guten Teilen geschafft, aber leider ist diese Mission unvollendet geblieben.
Wenn ein Journalist die Fronten wechselt, bespricht man ja mit dem neuen Chef, wie der Neue intern positioniert und anmoderiert wird. Idealerweise geht der Chef in die Führungsrunden und sagt: „Der Rogl kommt auf meinem Ticket und darf alles.“ War das bei Ihnen so?
Kein Mensch darf alles, auch bei Unister nicht. (lacht) Im Travel-Bereich, in dem ich eingestiegen bin, war ich operativ sehr eng eingebunden, da fiel das Ankommen sehr leicht. Später bei der Holding gab es keine solche Anmoderation, da bin ich reingewachsen.
Sie wurden vom Kritiker zum Kollegen – wie waren die Reaktionen der Mitarbeiter?
Bei einigen gab es anfangs Vorbehalte. Aber das macht einen loyalen Mitarbeiter ja aus, dass er dem ehemaligen Medienmann nicht sofort alle Firmeninterna erzählt.
Wie war Ihr Verhältnis zu Thomas Wagner?
Andere ehemalige Mitarbeiter behaupten, sie waren enge Freunde. Darauf war ich nie bedacht. Ich sehe das auch als Vorteil gegenüber externen Partnern. Aber wir hatten ein großes gegenseitiges Vertrauensverhältnis, tauschten uns regelmäßig aus. Ich schätze ihn, respektiere ihn, das hat unsere Arbeit stark gemacht.
Der Kommunikator muss dem Chef nahe sein, um ein guter Sparringspartner sein zu können und ihn bestmöglich zu positionieren. War das mit Herrn Wagner, der als nicht einfach im Umgang galt, möglich?
Wagner ist anders, als er von einigen dargestellt worden ist. Gerade bilateral ist er sehr offen und kritikfähig. Klar, er hat eine harte Verhandlungsführung, aber das macht einen guten Unternehmer aus. Er ist keine Rampensau und kommuniziert nicht gern in großer Runde. Er hat sich in all den Jahren zu wenig Zeit genommen, um seine Arbeit zu erklären, um auf Geschäftspartner, Mitarbeiter oder geschweige denn Medien zuzugehen. Aber wann immer er das doch getan hat, zum Beispiel in seinen wenigen Interviews, waren die Gesprächspartner beeindruckt von ihm.
Interessant, Sie sprechen plötzlich im Präsens von ihm, als wenn er noch lebt und gleich zur Tür hereinkommt.
Das mag der Situation geschuldet sein. Die Trauerarbeit ist ganz sicher beendet.
Brauchte eine Weile, bis er dem Interview zustimmte: Dirk Rogl übernahm den Job von Konstantin Korosides, der von 2009-2015 Kommunikations-Chef und in dieser Funktion sowohl für die nationalen und internationale Pressearbeit für die Holding als auch Portale wie ab-in-den-urlaub.de, geld.de oder fluege.de zuständig war(c) Oliver Fantitsch
Sie sprachen vorhin von externen Partnern. Wer hat Sie beraten in der Krise?
Bitte definieren Sie Krise.
Na, wenn das keine war …
Das Unternehmen steckte in dauerhaften, existenziellen Herausforderungen – und das schon vor meiner Zeit. Aber es gab für alle Themenbereiche immer eine stringente Strategie. Die größte kommunikative Herausforderung waren die Staatsanwaltschaft und der Verbraucherschutz. Dazu gab es Task Forces mit externer juristischer und kommunikativer Unterstützung. Die enge Verzahnung mit dem Operativen war mir immer wichtig.
Und Sie wussten immer alles, aber durften es nicht sagen?
Klar. Sie wissen Vieles und kommunizieren nicht alles. Seit 2012 wurde wegen Steuerhinterziehung und Computerbetruges ermittelt. Das sind schwere Vorwürfe, die Sie bis zur Verlesung der Anklage kaum parieren konnten. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Reputation und die Kapitalmärkte bei der Investorensuche. Wenn man vorher eine Wachstumsphase eingeleitet hat, die sich nicht ohne Weiteres bremsen lässt, sind Sie in einem Dilemma.
Generell gilt die Unschuldsvermutung, aber das tut sie in Wahrheit nur solange, wie sie von der Öffentlichkeit geteilt wird. Wir haben nie aus internen Protokollen oder Gerichtsunterlagen zitiert, um die Hauptverhandlung nicht vorwegzunehmen. Erst jetzt wird die Anklage verlesen. Für Unister kommt die nun durchaus mögliche kommunikative Schubumkehr leider viel zu spät.
Haben Sie für den Prozessbeginn ein Dossier samt Gedächtnisprotokoll in der Schublade?
Ich habe extrem viel in der Schublade – aber keinen Absender mehr. Ich bin kein Teil des Gerichtsverfahrens.
Wonach haben Sie als Kommunikator in der Akutphase Ihre Prioritäten gesetzt und entschieden, wer die wichtigste Zielgruppe ist?
Auch da galten nicht die klassischen Regeln, denn wir hatten es auch dort mit massiven strafrechtlichen Vorwürfen zu tun. Der Unternehmensleitung ging es nicht nur um die Trauer, dazu kam die Nachfolgeregelung und das Kriminalistische – da müssen Sie auch kommunikativ vorsichtig agieren. Sie können nicht so offen kommunizieren, wie Sie es gern möchten.
Wir hatten am Tag nach dem Flugzeugabsturz eine Betriebsversammlung mit allen Führungskräften. Solche Versammlungen haben sich schon zuvor als bestes Format der Information erwiesen, anders als schriftliche Kommunikation via Mailings oder das Intranet. Gerade bei der Todesnachricht war der persönliche Kontakt wichtig, wir brauchten Raum für Trauer.
Danach ging es darum, Gerüchte zu monitoren, zu kanalisieren und in informellen Gesprächen aufzuklären. Wir haben teilweise permanent mit Medienpartnern und Influencern geredet.
Wenn Sie gegenüber den Mitarbeitern die direkte Kommunikation bevorzugten – hatten Sie Angst vor dem Weiterleiten schriftlicher Informationen an die Medien?
Leider ja. Wir haben teilweise über die interne schriftliche Kommunikation indirekt die Medien informiert. Auf das Weiterleiten konnten wir uns quasi verlassen, denn nicht überall war die Loyalität da.
Wie groß war Ihre Abteilung?
Wir waren im Kernteam zu fünft, eine tolle Mannschaft.
Wer sprach mit wem?
Die wichtigen Gespräche habe ich selbst geführt.
Welchen inhaltlichen Fokus hatten die Presseanfragen?
Das war extrem vielfältig. Es gab keinen klaren Fokus, eher die für Unister typische Themen-Kakophonie.
Und Investor Relations war in Alarmbereitschaft?
Investor Relations war erst im Aufbau. Das war eines der vielen Dilemmata: Es gab bis dahin keinen Investor. (Anm. der Redaktion: Einen Tag vor Weihnachten 2016 verkündete der Insolvenzverwalter den Verkauf von Unister Travel an die Rockaway Capital SE.)
Eine weitere Kommunikationsmaßnahme war das Online-Kondolenzbuch für die Verstorbenen. Welche Idee steckte dahinter, und war das moderiert?
Ja, einer meiner Mitarbeiter hat das engmaschig monitort, wir hatten Angst vor beleidigenden Einträgen. Ein digitales Kondolenzbuch passte zu den Internetpionieren Wagner und Schilling, außerdem gab es im Umfeld eine große Betroffenheit, wir hatten viele Einträge aus der gesamten Branche und der regionalen Wirtschaft.
Sie haben aber auch andere Kommunikationswerkzeuge genutzt. Als 2015 das Handelsblatt über den drohenden Unister-Ruin schrieb – damals ging es um einen Streit mit einem Teilhaber und Veruntreuung – antworteten Sie mit einem offenen Brief an die Redakteure via Presse-Rundmail. Kam das gut an?
Ich hätte mir vorher nicht vorstellen können, dass ich als Sprecher einmal diesen Weg mitgehe, eben weil ich faire, direkte Kommunikation bevorzuge. Aber in dem Fall war diese Maßnahme richtig. Viele Dinge waren sehr plakativ und falsch dargestellt, auf unsere Argumente wurde nicht eingegangen. Ich glaube, das Handelsblatt hat uns das verziehen.
Gab es eine Antwort der Redakteure?
Ja, Wagner selbst hat dann einen persönlichen Dialog geführt. Es war der richtige Weg, er zeigte, wir lassen uns nur bis zu einem gewissen Grad mit geschäftsschädigenden Gerüchten konfrontieren.
2016 berichtete die MDR-Umschau von Betrugsfällen mit Reisegutscheinen. Sie unterstellten den Machern Kampagnenjournalismus. Sie als Journalist kennen den automatischen Reflex der Presse auf so einen Vorwurf und zogen trotzdem bis vor den Rundfunkrat. Was für eine Kampagne mit welchem Ziel haben Sie den Medien da unterstellt?
Das Thema Gutscheine zu hinterfragen, war absolut richtig. Der hier massiv geäußerte Vorwurf des Betrugs war es nicht. Hier wurden unsere Argumente weder gehört noch in die Berichterstattung aufgenommen. Es gab einige Medien, die intensiv den Kunstgriff genutzt haben, das angeblich kriminelle Image von Unister als Basis für weitere Recherchen zu nutzen. Ich gehe sonst kooperativ mit Medien um, man muss bei sowas Fakten sprechen lassen. Nur wurden die hier nicht gehört oder waren wegen der Regularien bei Anklagen nicht aussprechbar.
Die Redakteure waren vermutlich anderer Meinung. Wie haben die Medien reagiert?
Der Dialog endete nie in Aggressionen, er wurde fortgesetzt und in gute Bahnen gelenkt. Der Haken an Verbraucherschutzformaten ist immer: Sie haben multiple Ansprechpartner, die nicht immer gewillt sind, sich mit den Botschaften der Unternehmen auseinanderzusetzen. Und der Kontakt zu den Verbraucherzentralen selbst ist mühsam, wenn in deren Statuten steht, dass sie nicht mit Unternehmen sprechen. Dann ist ein Canossa-Gang zwar möglich, aber er führt zu nichts.
Die Medien hatten also Insider-Quellen?
Die gab es ganz sicher. Aber ich habe es nie als meine Aufgabe angesehen, die Quellen zu finden, sondern das Unternehmen so homogen, aufgeklärt und selbstbewusst zu machen, dass Insider keine Infos mehr rausgeben müssen. Das ist bei 2.000 Mitarbeitern mit multiplen Geschäftsbeziehungen, Partnern, Beratern und Gesellschaftern allerdings nicht einfach …
Welche Motivation sollten Mitarbeiter dafür haben, wenn sie damit ihren eigenen Arbeitsplatz gefährden?
Darüber kann man nur spekulieren. Ich glaube nicht, dass es aktive Mitarbeiter waren, die so massiv Informationen und leider auch falsche Gerüchte an Medien durchgestochen haben. Es mag ein fatales Zusammenspiel multipler Kräfte gewesen sein, die zu einer Kettenreaktion führten. Auch das sollte nun Aufgabe der Ermittler sein, denen muss unser Vertrauen gelten. Es ist nur vor allem für die Familien dramatisch, dass Thomas Wagner und Oliver Schilling sich nicht mehr selbst vor Gericht äußern können.
Das „fatale Zusammenspiel“ führte zu immer mehr Unbeherrschbarem?
Die Vorverurteilungen ruhten auf drei Säulen: Die staatsanwaltlichen Ermittlungen, das Engagement des Verbraucherschutzes und die gezielten Indiskretionen aus dem Unternehmensumfeld. Diese Wucht der Themen macht eine langfristige Kommunikationsstrategie sehr schwierig. In Einzelfällen gelingt das sehr wohl. Auf das ausufernde Engagement des Verbraucherschutzes haben wir etwa mit einem eigenen Blog reagiert. Sie können nur gewinnen mit Transparenz, indem Sie die Fakten sprechen lassen.
In der Auseinandersetzung mit dem MDR haben Sie dann einen kommunikativen Bypass gelegt: Im letzten Absatz Ihrer Entgegnung auf die „Medienkampagne“ wiesen Sie auf Ihre politische Kampagne #travelstatttrouble hin, für die sie unter anderem ein Riesenplakat gegen Rechts am Versammlungsort von Pegida-Demos in Leipzig entrollten. Hat das funktioniert als Ablenkung?
Die Kampagne war keine Ablenkung für den MDR. Sondern ein wichtiges Signal, dass wir nicht dem rechten Lager angehören, worüber ebenfalls massiv spekuliert wurde. Unister hat Mitarbeiter aus 35 Nationen, und wir waren in Sorge um den Wirtschaftsstandort Sachsen.
Nach den Themen Steuer- und Anlagebetrug dann auch noch Vorwürfe, das Unternehmen sei von Rechten unterwandert. Wann haben Sie gedacht: Jetzt reicht´s?
Nie. Es gab ja für alles eine Erklärung. Als es jedoch schließlich um die Insolvenz ging, war klar, dass eine Phase erreicht war, in der einzig und allein die Fortführung des operativen Geschäfts im Vordergrund zu stehen hat. Die Aufarbeitung der Altvorwürfe hatte sich schlagartig erledigt mit dem Flugzeugabsturz.
Haben Sie persönlich Haltungsentscheidungen treffen müssen?
Täglich.
Hatten Sie nie Angst, mit Ihrem Namen mit all dem in Verbindung gebracht zu werden?
Ich stehe zu allem, was ich gesagt habe. Aber das kann ich auch nur, weil ich im Unternehmen Dinge kritisch hinterfragt habe. Meine Aufgabe war nicht nur die Kommunikation, sondern die Einflussnahme auf Thomas Wagner und das gesamte Managementteam, um Dinge zu verbessern. Das ist mir in Teilen auch gelungen. Mein Job funktionierte nur mit einer hohen Glaubwürdigkeit.
Nach dem Absturz und der drohenden Insolvenz kam die nächste Pressemitteilung nicht mehr von Ihnen sondern von einer PR-Agentur weit weg in Köln. Warum?
Das ist ein normaler Prozess: Unser Insolvenzverwalter war neu im Unternehmen und geht ein hohes Risiko ein. Er muss sich einer enormen Komplexität stellen und tut gut daran, in allen Bereichen seiner Tätigkeit eingespielte Prozesse einzuführen, und Menschen mitzubringen, denen er voll vertraut. Eine Insolvenz ist ja keine One Man Show.
Ist es ratsamer, in Zeiten einer solchen Transition ein bekanntes Gesicht mitzunehmen – oder muss das Gesicht der Krise weg?
Ich bin ja weiter an Bord geblieben, mein Gesicht war intern also immer da. Wenn ein Unternehmen dauerhaft unter Beschuss steht, ist es gut, mehr als ein Gesicht nach außen zu haben. Darunter muss ein Mitglied der Geschäftsführung mit möglichst hoher operativer Verantwortung sein. Das hat bei Unister gefehlt. Aber in einer Insolvenz kann es nach außen nur ein Gesicht geben – und das muss das des Insolvenzverwalters sein.
Holte nach seinem Ausstieg erstmal den Urlaub nach: Dirk Rogl (c) Oliver Fantitsch
Die Pressemitteilung zu Ihrem Ausstieg kam dann wieder von Ihnen. War es Ihnen wichtig, die persönlich zu veröffentlichen?
Ja.
Es hieß, Sie stünden „dem Unternehmen weiter beratend zu Seite“. Wie?
Ich war operativ stark eingebunden, es ging darum, Projekte zu beenden und Verhandlungen zu führen. Kommunikation bedeutet ja nicht nur Medienarbeit. Es ging hier um Branchen- und lokale Wirtschaftsbeziehungen. Und es ging darum, den Kunden zu erklären, weshalb sie auf den Portalen trotz Insolvenz weiter sicher ihre Reisen buchen können. Das ist gelungen.
Die Geschichte ist von außen betrachtet spannend wie ein Krimi.
Ja, das ist sie ganz gewiss – allerdings wäre dieser Krimi zu komplex für ein Buch oder einen Tatort.
Zwischen der Pressemitteilung zu Ihrem Aufstieg in die Holding und Ihrem Ausstieg vergingen gerade einmal drei Monate. Was macht das mit Ihnen persönlich?
Es macht hellwach. Und es fühlt sich eindeutig länger an als drei Monate.
Und als Nächstes?
Nach so einer Sache möchte ich erstmal Abstand gewinnen, die Zeit gönne ich mir auch. Ich werde mit der Familie den Urlaub nachholen und sortiere ich mich ein wenig. Dann mache ich etwas Neues.
War 2016 das krasseste Jahr Ihrer Karriere?
Das will ich hoffen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe FÜHRUNG. Das Heft können Sie hier bestellen.