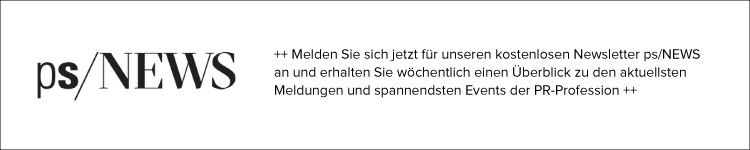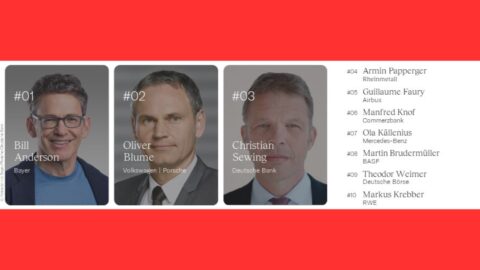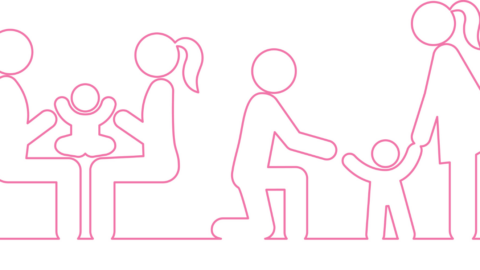Frau Niedner, Konkurrenz belebt zwar den Markt, genießt aber im Zwischenmenschlichen keinen guten Ruf. Meistens wird sie mit Neid und Missgunst konnotiert. Ist das gerechtfertigt?
Barbara Niedner: Verhaltensbiologisch gesehen beschreibt Konkurrenz einfach den Wettbewerb um knappe Ressourcen und darum, agil wandlungsfähig zu sein, um sich an vorhandene Umweltbedingungen wie aktuell die Digitalisierung anpassen zu können. Im biologischen Kontext ist dieser Wettbewerb – solange es nicht zu Monokulturen kommt, die gezielt Konkurrenz ausschalten – sehr positiv.
– Anzeige –
Aber auch Neid ist nichts Schlechtes, sondern das beste Controlling dafür, dass man an Einfluss gewinnt. Wenn andere uns beneiden, wissen wir, dass wir selbst vorangekommen sind. Nur wer es schafft, Missgunst auszuhalten, hat die Fähigkeit, überhaupt oben anzukommen. Das betrifft Individuen genauso wie Firmen oder Branchen.
Neid „von oben“ betrachtet mag nicht schlecht sein. Aber was, wenn ich es bin, der ihn verspürt – zum Beispiel, weil statt meiner immer nur die Kollegen um mich herum befördert werden?
Anstatt darüber zu jammern, muss ich mich fragen: Was habe ich dazu beigetragen, dass die Oberen nicht auf mich aufmerksam werden? Das ist wiederum Controlling in Bezug auf meine eigene natürliche Autorität. Wenn andere mich übergehen, hat das eine Alarmfunktion: Jetzt bitte aufwachen und die eigene Präsenz steigern!
Natürliche Autorität erscheint allerdings – wie der Name schon suggeriert – als etwas Gegebenes, das ich entweder habe oder nicht. Kann ich sie trainieren?
Teilweise. Es gibt Menschen, die werden niemals zu Führungspersönlichkeiten. Denn dafür brauche ich ein gewisses Standing und muss soziale Fähigkeiten für die Gruppe nutzbringend einbringen. An wen erinnern Sie sich, wenn Sie eine Feier verlassen? Ganz sicher haben nicht alle 200 Personen einen Eindruck hinterlassen, sondern die mit einer speziellen Ausstrahlung und Körpersprache.
Natürliche Autorität ist aber nicht nur für Führung vonnöten, sondern in einem gewissen Maß auch für meine alltägliche Arbeit, egal ob es darum geht, einen Text zu schreiben, der Aufmerksamkeit bei Menschen erzielt, oder mein Projekt zu präsentieren. Fachlich komme ich nicht weiter, wenn die anderen mich nicht wahrnehmen – es geht wieder um Aufmerksamkeit. Expertise und selbstbewusstes Auftreten können wir sehr wohl beeinflussen.
Werde ich kreativer, wenn ich den Druck der Wettbewerber spüre?
Ja, je mehr Konkurrenz ich habe, desto mehr muss ich auf Trab bleiben, um mich durchzusetzen mit meinen Ideen. Wenn wir keine Konkurrenz hätten, wären wir nicht wandlungsfähig, und Agilität ist gerade in Zeiten der Digitalisierung unverzichtbar. Ohne Wettbewerb würden wir einschlafen und wären nicht mehr überlebensfähig. Dank ihm machen wir uns überhaupt die Mühe, neue Ideen und Optionen zu entwickeln.
Das ist also ein evolutionärer Prozess.
Ja. Wer wandlungsfähig ist und sich an die Umwelt und die eigene Gruppe perfekt anpassen kann, der ist besonders erfolgreich. In der Gruppe versuche ich mir natürlich eine möglichst gute Ausgangsposition zu verschaffen, um meine Lebensbedingungen zu verbessern. So ist es auch im Tierreich: Das schwächste Glied wird irgendwann vom Jäger erbeutet. Je höher meine Position innerhalb der Gruppe ist, desto besser sind also meine Voraussetzungen, zu überleben und meinen Nachwuchs großzuziehen.
„Die Mehrheit ist begeistert,
wenn sie hinterherlaufen darf.“
Bei Hyänen ist es zum Beispiel so: Das Alphaweibchen zieht im Jahr normalerweise zwei Jungtiere auf, ein rangniedrigeres Weibchen bekommt in schlechten Jahren nicht ein einziges durch. Ranghöhere dürfen zudem im inneren Zirkel jagen, ein Umkreis, der ihnen vorbehalten ist. Die Übrigen müssen sich weiter herauswagen, um sich Futter zu beschaffen, und sind dort weniger geschützt. Ähnlich ist es bei Gorillas, das ranghöhere Weibchen hat eine bessere soziale Struktur. Wer am Rand der Gruppe ist, ist stärker gefährdet. Wer im Zentrum sitzt, ist geschützt.
Im Unternehmen ist es ähnlich. Ich werde in höherer Position eher gesehen, kann den vorderen Parkplatz nutzen, habe mehr Budget und Einfluss – all das sind die Futtertröge der Macht.
Nun ist aber nicht jeder gleichermaßen daran interessiert, diese zu erobern, oder?
Stimmt. Eine Minderheit bekommt die Macht verliehen, die knappen Ressourcen zu verteilen. Und die Mehrheit der Menschen folgt ihr gern. Denn wer Macht hat, hat viel Verantwortung und muss damit auch Stress aushalten können, das möchte nicht jeder.
Wir kennen das auch im Privaten. Stellen Sie sich eine Gruppe Freunde vor, die aus einer Kneipe heraustritt. Die Frage steht im Raum, wohin sie weiterzieht. Wenn es keinen gibt, der natürliche Autorität besitzt und einen Vorschlag macht, den weiteren Verlauf organisiert, löst sich die Gruppe schnell auf. Dann fällt nämlich nach und nach allen ein, dass sie morgen arbeiten und eigentlich dringend ins Bett müssen. Natürliche Autorität kann den Zerfall der Gruppe verhindern. Wer einen Vorschlag macht, exponiert sich in der Gruppe und muss mit Gegenwind rechnen; die anderen werfen dieser Person vielleicht vor, sie habe ihren Willen durchsetzen müssen. Das liegt nicht jedem. Die Mehrheit ist begeistert, wenn sie hinterherlaufen darf.
Verantwortung kann schwer auf uns lasten.
Hinzu kommt: Im Tierreich ist es so, dass Alphatiere meistens kürzer leben, weil sie den höheren Stressfaktor haben, die Gruppe verteidigen müssen, konkurrieren. Macht hat also einen Preis. Habe ich eine gute Führung, ist es also viel einfacher, mitzulaufen, als oben den Kopf hinzuhalten.
Doch auch wenn ich keine Lust auf Verantwortung und Stress habe, kann ich anderen ihre Vorteile und Statussymbole neiden. Wovon hängt es ab, ob wir Konkurrenz als bedrohlich oder herausfordernd empfinden?
Wenn ich eine gute Führungskraft habe und weiß, dass diese mich im Unternehmen schützt, hinter mir steht, wenn etwas schiefläuft, und mir passende Aufgaben und Arbeitsmittel – sozusagen „mein Futter“ – zuteilt, hat das für mich einen hohen Nutzwert. In so einem Fall nehme ich Konkurrenz zum Beispiel zu anderen Teams eher als positiv wahr. Sind diese Rahmenbedingungen nicht gegeben, fühle ich mich ausgenutzt und mache nur noch das, was unbedingt sein muss. In der Situation beginne ich, andere zu beneiden.
„Im Tierreich ist es so,
dass Alphatiere meistens kürzer leben.“
Manche Menschen verspüren – trotz der beschriebenen Nachteile – den Drang, sich an die Spitze zu arbeiten. Liegt dieser Ehrgeiz in unserer Genetik oder ist er eher eine Frage der Erziehung?
In erster Linie ist er angeboren. Aber die Erziehung hat schon Einfluss auf das Wettbewerbsempfinden. Wenn das Kind nur Gummibärchen bekommt, wenn es dafür etwas geleistet hat, oder mit Erfolgsdruck immer wieder in sportliche Wettkämpfe geschickt wird, prägt das natürlich. Ich kann auch zu Egoismus erziehen, Ellbogenmentalität vermitteln.
Wir haben mal Studien in einem Kindergarten gemacht. Wenn keinerlei Rahmenbedingungen gesetzt werden, entstehen dort Rambo-Kulturen: Derjenige, der wortwörtlich alle niederschlägt, gelangt nach oben. Um das zu vermeiden, sollten Unternehmen Spielführermentalitäten etablieren, beispielsweise, dass im übertragenen Sinne nicht geschlagen wird, dass alle sich an gewisse Werte halten.
Leider gibt es Rambo-Kulturen auch in der Erwachsenenwelt. Ich denke zum Beispiel an die TV-Landschaft: In politischen Talkshows erreichen die Gäste die größte Aufmerksamkeit, die am härtesten austeilen, egal wie platt oder absurd die Äußerungen sind.
Sehen Sie – gerade was mediale Schaukämpfe anbelangt – eine stärker werdende gesellschaftliche Tendenz in diese Richtung?
Wir messen Hierarchien in der Natur damit, wie oft ein Tier angeschaut wird. Aufmerksamkeit ist also immer die Währung. Medien, insbesondere Massenmedien, bündeln Aufmerksamkeit, dadurch wird sie immer exponentieller und ungleichmäßiger verteilt. Durch Social Media nimmt das noch einmal extremere Formen an. Aufmerksamkeit zu generieren und zu multiplizieren ist durch Twitter, Instagram und Co. sehr einfach geworden. Dieser dadurch immer wüster werdende Kampf um die meiste Aufmerksamkeit, darum, den eigenen Markenwert zu steigern, entspricht dem natürlichen menschlichen Verhalten eigentlich überhaupt nicht mehr.
Seite 2: „In der Arbeitswelt ist es wie bei Schimpansen: Wenn sich einer durchgesetzt hat, wird er gekrault.“
Gerade ambitionierte Mitarbeiter inszenieren sich oft geschickt als ihre eigene Marke, um sich von der Konkurrenz abzuheben.
Ja, vor allem Anderssein muss sich eine Marke schaffen, um akzeptiert zu werden. Diese Monopolstellung einzelner Personen im Unternehmen, die für eine gewisse Zeit im absoluten Fokus stehen, ist aber immer Schwankungen unterlegen. Niemand bindet die Aufmerksamkeit ewig an sich, nach einer Zeit erregen andere „Marken“ mehr Interesse.
Ist in Ökosystemen generell eine friedliche Koexistenz gut angepasster Arten und solcher, die weniger gut an ihre Umweltbedingungen angepasst sind, möglich?
So etwas wie „weniger angepasst“ gibt es gar nicht. Jede existierende Art, egal wie exotisch, hat sich in ihre Nische im Ökosystem eingefügt, sonst wäre sie bereits ausgestorben. Auch wenn uns manche Eigenarten nutzlos oder wunderlich erscheinen: Sie haben immer einen Überlebenswert.
Ich habe gerade Murmeltiere in den Alpen beobachtet, die wirken ein bisschen wie Relikte aus der Eiszeit. Dort oben haben sie wenige Feinde, sie sind perfekt an die Bedingungen angepasst. Es ist unglaublich, wie dick diese Tiere vor dem Winter werden! Nun würden wir Menschen vermuten, es macht sie träge, sich so fett zu fressen – aber das ist ihr bester Schutz!
„Wir messen Hierarchien in der Natur damit,
wie oft ein Tier angeschaut wird.“
Die Umweltbedingungen verändern sich, die Arten müssen evolutionär Schritt halten.
Ja, aber auch nicht um jeden Preis. Es gibt Arten, die sich jahrhundertelang kaum verändert haben, weil sich ihre Eigenschaften bewähren. Veränderung gibt es nur, wenn sie einen konkreten Nutzwert hat.
Zum Thema Konkurrenz wird oft eine eigene Gender-Debatte heraufbeschworen. Ist unser Geschlecht ausschlaggebend dafür, wie wir Hierarchien leben?
In der Natur unterscheiden sich männliche und weibliche Hierarchien komplett voneinander. Unter Männchen herrscht Konkurrenz um die knappe Ressource Weibchen. Dadurch sind Männer von klein auf mehr auf Wettbewerb ausgerichtet. Generell sind sie viel präsenter in ihrem Konkurrenzverhalten. In der Unternehmenswelt ist es leider so, dass Männer nach wie vor die Führung oft nur unter sich ausmachen, also von vornherein den Wettbewerb um 50 Prozent verkürzen. Dadurch wird es für sie einfacher, nach oben zu kommen. Männerhierarchien sind aber sehr kurzfristig.
Gilt das auch für die Tierwelt?
Absolut. Wenn Sie eine Schimpansengruppe beobachten, werden Sie feststellen, dass nach einer Weile die Alphatiere einander ablösen. Weil die Obersten schwächeln oder weil sich andere durch Stärke und Intelligenz hervorgetan haben, kommt es zum Wechsel. Aber auch hier gibt es – wie in Chefetagen oder der Politik – immer mal wieder Fälle, in denen eine Person einfach viel Krach um nichts macht und sich damit Aufmerksamkeit verschafft, andere einschüchtert und an die Spitze gelangt.
Und der geschasste Schimpanse fügt sich einfach in sein Schicksal?
Das ist unterschiedlich. In dem geschilderten Fall haben Drohgebärden ausgereicht, um den Kontrahenten dazu zu bringen, sich unterzuordnen. Dieses Gehabe dient dazu, körperliche Auseinandersetzungen zu umgehen. Der unterworfene Affe hat den Sieger am Ende sogar gekrault. Wer sich größer aufplustert, darf damit rechnen, dass der andere ein submissives Signal gibt: Du bist der Chef. Solches Verhalten können wir auch in der Arbeitswelt beobachten. Zum Beispiel innerhalb von Ringkämpfen in Meetings. Wenn sich einer durchgesetzt hat, wird er vom anderen gekrault.
… oder aber der Entthronte will keinen Tag länger im Unternehmen bleiben, weil er die Schmach nicht auf sich sitzen lassen kann.
Ja, in der Natur kommt auch das vor. In diesem Fall entfernt sich das Tier von der Gruppe und sucht sich eine neue – seine Überlebensbedingungen verschlechtern sich aber während der Wanderschaft. Das sehen wir zum Beispiel bei Gorillas oft.
Und wie funktionieren weibliche Hierarchien?
Ihre Gemeinschaften haben in der Regel viel langfristigere Strukturen. Bei Affenweibchen ist das sehr ausgeprägt. Paviane werden zum Beispiel in Hierarchien hineingeboren, die Mutterlinie bestimmt über Generationen den Status. Gehören sie einer ranghohen Linie an, ist sie ihnen auf Lebenszeit sicher. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu den flexiblen Strukturen bei Männern, wo permanent der Aufstieg versucht, sich aufgeplustert und getrommelt wird. Weibchen machen das weniger, weil die Rangfolgen – sind sie einmal geklärt – sehr stabil sind.
„In der Natur unterscheiden sich männliche
und weibliche Hierarchien komplett voneinander.“
Das heißt aber auch, dass die Aufstiegschancen gering sind.
Bei manchen Arten ja, bei den Menschenaffen gibt es ein bisschen mehr Roulette. Auch beim Menschen erkennen wir dieses Verhalten in Ansätzen. Frauen haben meist sehr viel stabilere Freundschaften und Netzwerke, die über Jahrzehnte gepflegt werden. Dadurch, dass die Hierarchien so lange bestehen, gibt es bei Frauen, wenn man sie zusammenbringt, am Anfang viel härteres Konkurrenzgerangel.
Dazu fällt mir die schreckliche Bezeichnung „Stutenbissigkeit“ ein … Hat sie eine Berechtigung?
In dem Sinne ja. Schon in Gruppen junger Mädchen wird stark um den Status gerungen. Es geht einfach um sehr viel mehr als bei Männern, weil die einmal festgelegten Hierarchiestufen sich fixieren. Weibliches Wettbewerbsverhalten ist gleichzeitig aber subtiler. Es wird längst nicht so viel geblufft und getrommelt. Frauen entziehen die Aufmerksamkeit – eine wichtige Währung für Einfluss – oder setzen Grenzen kurz und bündig, die weniger offensichtlich sind als das männliche laute Trommeln.
Wenn Frauengruppen sich aber einmal etabliert haben, bringen sie ein tolles Netzwerk zustande, das für jedes Mitglied einen hohen Nutzwert bringt. Sie achten sehr stark darauf, dass das soziale Gefüge stimmt und Ressourcen gerecht verteilt werden.
Nutzwert auch insoweit, als Frauen sich gegenseitig an die Spitze bringen?
Früher galt: Wenn eine Frau es im Unternehmen nach oben schafft, zieht sie keine andere nach – im Gegensatz zu Männern und ihren Seilschaften. Das ändert sich allerdings langsam, die gegenseitige Unterstützung nimmt zu. Es ist gut, dass sich der Wettbewerb immer mehr Richtung 100 Prozent erhöht und Frauen nicht mehr ausklammert. Vielfalt macht ein Unternehmen überlebensfähiger – besonders in disruptiven Zeiten. Die guten „Alphatiere“ werden sich an der Spitze durchsetzen, egal ob männlich oder weiblich. Da können Unternehmen von der Natur lernen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KONKURRENZ. Das Heft können Sie hier bestellen.