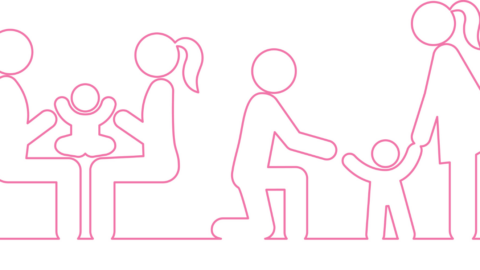Herr Kuffner, geben Sie mir bitte nähere Einblicke in Ihren Sport! Die klassische Länge einer Ruderregatta beträgt 2.000 Meter. Ab wann beginnt es, wehzutun?
Andreas Kuffner: Allerspätestens nach 500 Metern (lacht). Es ist dann die Kunst, seine Kräfte so einzusetzen, dass man die restlichen 1.500 durchhält. Das ist wie im Beruf: Es bringt nichts, sich in einem Projekt für ein paar Tage extrem reinzuhängen, kurz danach aber pausieren zu müssen, weil man „überzogen“ hat.
Wie sehr pusht Konkurrenz?
Sie bringt dich dazu, im direkten Vergleich über Grenzen hinauszugehen. Im laufenden Training motiviert Konkurrenz. Aber sie kann dich – auch psychisch – ebenso mürbemachen. Wenn du nämlich in Stress gerätst und dadurch blockiert bist.
Zu wissen, dass die Anstrengung den Konkurrenten genauso wehtut oder noch mehr – wie sehr hilft das?
Es ist tröstend zu wissen. Ein Beispiel: Im olympischen Finale 2012 hatten wir auf der Regattastrecke seitlichen Gegenwind. Mir war gleich klar, das würde hart werden. Der Kraftaufwand ist höher, das Boot instabiler. Noch heute kann ich mich jedoch an den Gedanken erinnern: Hey, unsere Konkurrenten haben genau die gleichen Bedingungen wie wir!
Wie läuft die Selektion der Besatzung für den Deutschland-Achter ab?
Es ist ein ständiger Konkurrenzkampf um die acht Rollsitze. Basis für die Selektion sind jedes Jahr aufs Neue die individuellen Leistungen im sogenannten Zweier ohne Steuermann. Das heißt, man vergleicht seine eigenen Ergebnisse ständig mit anderen Zweiern. Mal auf Kurz-, mal auf Langstrecken, auch mit wechselnden Partnern. In Trainingslagern gibt es etwa jeden dritten Tag Testrennen. Da kann es sein, dass man am Vormittag im Zweier gegen Konkurrenten rudert, die am Nachmittag – buchstäblich – im selben Boot sitzen. So wird aus Kontrahenten plötzlich ein Team. Das ist spannend …
… bedeutet aber auch Stress, oder?
Ja. Denn dieser Konkurrenzkampf herrscht das ganze Jahr über. Von Oktober bis Ende April ist praktisch alles offen. Bis wenige Wochen vor einem Saisonhöhepunkt kann sich keiner sicher sein, ob er fest für den Achter eingeplant ist oder nicht. Vorher beäugt man sich untereinander, vergleicht seine Leistungsdaten insgeheim, kalkuliert, hängt sich voll rein. Immer mit dem Risiko, dass sich die Investition an Energie am Ende gar nicht gelohnt haben wird, weil der Trainer einen anderen für den Achter auserwählt. Psychologisch kann einen dieses Risiko extrem stressen. Oder ermüden.
Klingt nach anstrengender Kopfsache.
Es kann passieren, dass man an den Stärken interner Konkurrenten zugrunde geht. Nicht weil sie unbedingt besser wären. Sondern weil sie mehr an sich glauben als du selbst an dich oder weil sie ihre Schwächen nicht als so negativ empfinden wie du deine eigenen. Gleichzeitig Konkurrent und Teamkamerad zu sein, ist nicht leicht. Es bedarf insofern einer Offenheit für dieses System der Auswahl, wie wir es im Deutschen Ruderverband haben. Und es braucht viel Selbstreflexion.
Haben Sie Sportkameraden an diesem ständigen Konkurrenzdruck scheitern sehen?
Ja. Ich selbst habe Situationen großen Selbstzweifels erlebt. Beispielsweise hatte ich 2015 einen Bandscheibenvorfall, habe es im olympischen Jahr darauf aber dennoch geschafft, wieder für den Achter nominiert zu werden. Nicht alle waren darüber begeistert. Schon gar nicht derjenige, der an meiner Stelle seinen Rollsitz im Boot räumen musste – ein Berliner Vereinskollege obendrein. Sein Umfeld hat in Medien und in sozialen Netzwerken gegen mich gewettert. Mit dieser Kritik umzugehen, fiel mir nicht leicht. Einerseits war ich froh, die Nominierung für den Achter gemeistert zu haben. Andererseits tat mir der Kollege leid. Ich bin per se sehr selbstkritisch. Ich fragte mich: Haben die vielleicht recht? Am Ende gaben mir aber auch die objektiven Kriterien recht.
Welche – möglicherweise subtilen – Möglichkeiten haben Trainer abseits der internen Rennen, Konkurrenz zu forcieren?
Zu meiner Zeit im Achter hieß der Bundestrainer Ralf Holtmeyer. Sein Credo lautete: „Ich will keine Thekenmannschaft.“ Harmonie war ihm nicht das Wichtigste, gerade in der frühen Phase der Selektion nicht. Ralfs Priorität war, dass sich jeder individuell weiterentwickelt. Nach dem Training hängte er Ergebnislisten öffentlich aus. Das heißt, jeder Ruderer konnte sehen, wo er persönlich steht – und wo seine Konkurrenten. Solche Transparenz ist nicht immer angenehm, glauben Sie mir! Noch bei der traditionellen Präsentation der Achter-Mannschaft im Mai für die Medien hat der Trainer stets betont, dass Umbesetzungen auf einzelnen Positionen nach wie vor denkbar seien. Für mich als Sportler hieß das, extrem ausgedrückt: Ich lebte unter ständigem Druck, meinen Platz noch zu verlieren.
Das, wovon Sie erzählen, dürfte mitunter zu Reibereien im Mannschaftsgefüge geführt haben. Wie äußerten die sich?
Mein Eindruck war, dass jeder aus der Besatzung ehrliches, kritisches Feedback eingefordert hat. Keiner hat den anderen angeschrien oder beleidigt. In der Vorsaisonphase, in der noch wechselnde Besatzungen getestet wurden, gibt man seinen Kollegen im Boot auch mal technische Hinweise oder Tipps. Denn wenn der Einzelne sich verbessert, rudert die ganze Mannschaft schneller. Das finde ich eine sehr positive Charaktereigenschaft von Sportlern, dass sie sich trotz aller Konkurrenz gegenseitig unterstützen. Offenes Feedback ist aus meiner Sicht wichtig und Teil des Erfolgs.
Ähneln sich die Ruderer einer guten Achter-Crew charakterlich?
Nicht unbedingt. Gewisse Eigenschaften wie Teamfähigkeit oder die Entschlossenheit, im entscheidenden Moment über die eigenen Grenzen zu gehen, sollte zwar jeder mitbringen. Es ist, meine ich, aber notwendig, verschiedene Charaktere in einer Mannschaft zu haben. Von Rampensau über Diva bis hin zum Schweiger ist manchmal alles in einem Boot vertreten. Am Ende führt diese Ungleichheit aus meiner Sicht zu einer besseren Leistung. Das ist wie im Unternehmen: Gleichförmigkeit in der Belegschaft ist aus meiner Sicht nicht förderlich.
Wie hoch war der Aufwand, den Sie als Leistungssportler betrieben haben?
Im vorolympischen und olympischen Jahr 30 bis 35 Stunden Training pro Woche plus Physiotherapie. Nebenbei das Studium mit 20 bis 25 Stunden. Dazu die Pendelei über 500 Kilometer zwischen meinem Studienort Berlin und dem Ruderstützpunkt in Dortmund, dienstags hin, sonntags zurück, meist mit dem Auto. Zeit für sich selbst ist knapp. Pro Jahr hatte ich vielleicht vier Wochen Urlaub, in denen ich meist sogar locker etwas trainiert habe. Eine Beziehung aufrechtzuerhalten, ist vor dem Hintergrund Arbeit. Glücklicherweise ist meine Freundin diesen Weg mit mir gegangen. Inzwischen sind wir verheiratet (lacht).
Wie intensiv haben Sie sich als Mannschaft mit Ihren Konkurrenten aus anderen Ländern beschäftigt?
Nicht ständig, aber immer wieder. Man schaut, wie die trainieren, wohin sie ins Trainingslager fahren, welche Rennzeiten sie in Wettkämpfen haben, und checkt sogar, auf welche Länge deren Riemen eingestellt sind.
Wie das?
Unser Steuermann ist es mit einem Maßband nachmessen gegangen. Das haben unsere Konkurrenten umgekehrt ebenso gemacht. Alles in allem geht es darum, stetig zu lernen und sich zu vergleichen, dabei eigene Schwächen zu erkennen, aber auch eigene Stärken oder Alleinstellungsmerkmale auszumachen. Das führt letztlich zu mehr Motivation.
Sie haben mit dem Olympiasieg das Höchste erreicht, was ein Ruderer erreichen kann. Sie hätten anschließend Ihre Karriere beenden können. Warum haben Sie es nicht getan?
Eigentlich hatte ich mir schon Anfang 2012 fest vorgenommen, nach dem olympischen Jahr aufzuhören. Mental war ich ausgelaugt, und nicht wenige haben mir nach dem Sieg in London dazu geraten und gemeint, ich könne ab jetzt nur noch verlieren. Aber dieses olympische Gefühl, Gold zu gewinnen, war so überwältigend für mich und hat mich so mitgerissen, dass ich nach einem Jahr bewusster Wettkampfpause große Lust bekam, mich für die Spiele 2016 abermals zu quälen.
Haben Sie die Befürchtung, dass Ihnen das, was Ihnen der Sport emotional gegeben hat, in Ihrem Berufsleben womöglich ähnlich intensiv nie mehr widerfahren wird?
Festgestellt habe ich es bereits (lächelt). Meine Befürchtung war eher, nicht das zu finden, was mich nach der Sportlerkarriere glücklich macht. Und ich verspürte, obwohl ich ja mit meinem Studienabschluss gut aufgestellt war, eine gewisse Existenzangst, das gebe ich zu. Olympisches Gold gewonnen zu haben, ist schön und gut. Aber quasi bei Null anfangen zu müssen, und das in einem fortgeschrittenen Alter, ist eine Herausforderung. Man muss bereit sein, zu lernen. Es braucht viel Selbstreflexion, auch Mut. Am Ende ist der Leistungssport schließlich auch eine Komfortzone gewesen.
Inwiefern?
So anstrengend der Alltag ist: Man weiß als Sportler, was man an ihm hat und was man zu tun hat. Für mich war der Schritt in den Beruf kein leichter, aber ein bewusster. Sehr geholfen hat mir der Gedanke, dass nicht Krankheit, nicht Verletzung, nicht der Trainer mein Karriereende bestimmt hat – sondern dass ich selbst diese Entscheidung traf.
Wie hat sich der Prozess der Abnabelung vom Leistungssport gestaltet?
Am Anfang war ich total glücklich, zumal ich mit dem Achter 2016 noch einmal Silber gewonnen hatte. Im ersten Job nach der Sportlerkarriere habe ich dann irgendwann festgestellt, dass ich noch sehr auf der Suche bin. Das hatte auch auf das Privatleben Auswirkungen und auf mein Selbstbewusstsein. Ich hatte ein wenig das Gefühl, plötzlich gar nichts mehr so richtig zu können. Ich suchte nach einer Antwort auf die Frage: Wer bin ich, der ehemalige Leistungssportler und Student, der immer volle Power gegeben hat, heute eigentlich?
Inzwischen wähne ich mich auf einem sehr guten Weg. Ich habe einen neuen Job in einer Unternehmensberatung angetreten, halte Vorträge und absolviere eine Ausbildung zum systemischen Coach. Das hilft mir extrem dabei, mich selbst weiterzuentwickeln, nach Lösungen zu suchen und nicht in Problemen zu verharren. Die Ausbildung ist insofern ein Stück weit auch Selbsthilfe (lacht).
Sind Ex-Leistungssportler die besseren Arbeitnehmer?
(überlegt) Sie können sehr wertvolle Arbeitnehmer sein – wenn sie bereit sind, neu zu lernen. Und wenn Arbeitgeber das enorme Potenzial an Soft Skills erkennen, das sie mitbringen. Intrinsische Motivation etwa, Teamfähigkeit, Ausdauer.
Was Sie im Arbeitsleben nun nicht mehr erhalten, ist Applaus.
Das stimmt. Aber es stört mich weniger als der Mangel an Adrenalin. Das vermisse ich teilweise (lacht).
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KONKURRENZ. Das Heft können Sie hier bestellen.