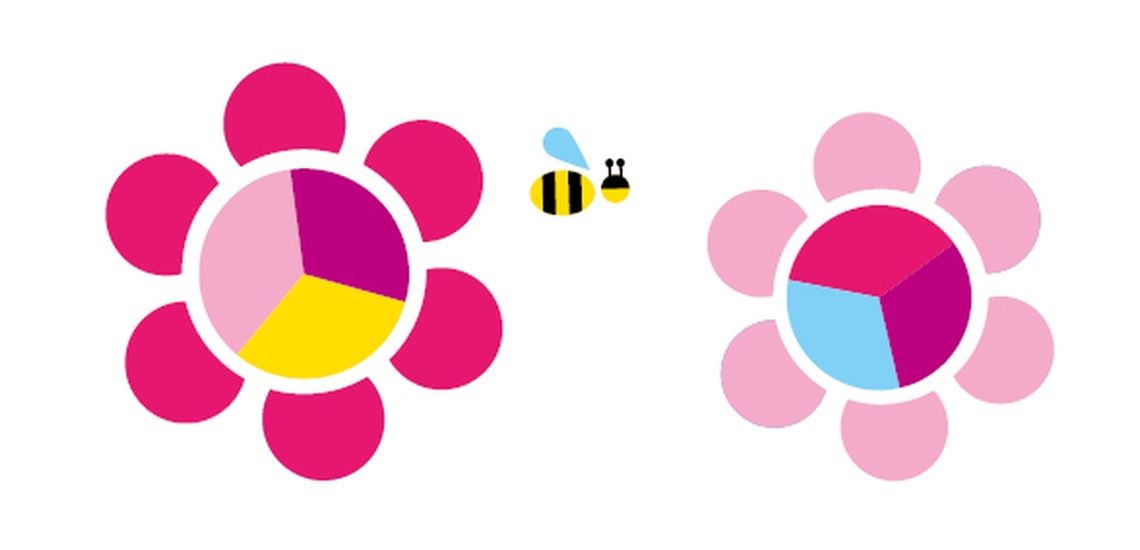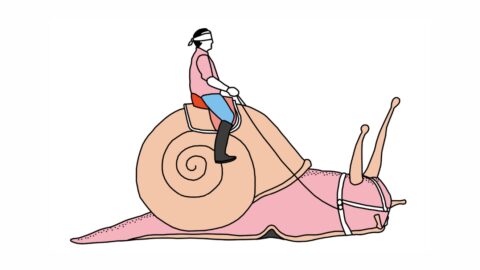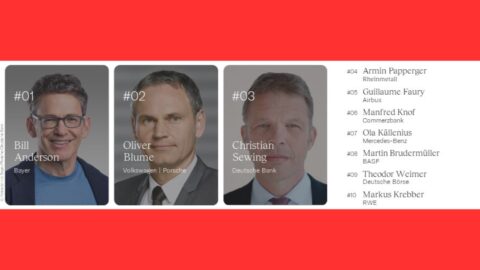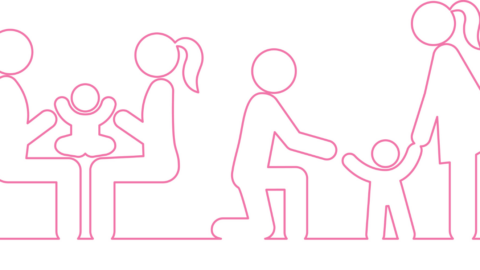Kann man überhaupt von Liebe sprechen, wenn es um den eigenen Beruf geht? Der Schriftsteller Alain de Botton nannte die Liebe eine „romantische Selbsttäuschung“, arbeitete sich in seinem Kurzroman „Versuch über die Liebe“ an dem großen Begriff und dessen „semantischer Ungenauigkeit“ ab. Für die Liebe zwischen Menschen fand er dennoch einige Klarheiten in seinen philosophischen Betrachtungen. Sein namenloser Romanheld erlebt, wie Wörter alles ermöglichen oder vernichten können, wie man versucht, die persönliche Beteiligung möglichst klein zu halten, obwohl der andere einem alles bedeutet; nur aus Furcht vor Zurückweisung. Er spürt das Locken anderer Frauen, merkt später, dass es nur die Angst vor dem Glück war. Er geht mit der Liebe unter und gestärkt wieder aus ihr hervor. Lassen sich diese Gedanken auch auf unser Berufsleben übertragen? Zumindest sollten wir – ähnlich wie bei unserem Lebenspartner – prüfen, wen wir vor uns haben.
Arbeits- und Freizeit?
Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit ist diffus geworden und dadurch vermischen sich auch die Gefühle, die wir privat und beruflich haben. Der Begriff Work-Life-Balance und Abwandlungen wie Work-Life-Integration und Work-Life-Blending versuchen diese Unentschlossenheit einzufangen – und uns zumindest begrifflichen Halt zu geben in Zeiten der Entgrenzung, der überall verlangten Flexibilität. Arbeitszeit ist nicht mehr klar abgesteckt, unsere Gedanken kreisen um Aufgaben, Kunden und Kollegen. Bei der Hamburger Agentur Elbdudler können die Mitarbeiter sogar Gehalt und Urlaub selbst festlegen. Unsere Arbeit fließt in all unsere Lebensbereiche, sie bemächtigt sich unser.
Diese Vermischung lässt auch unsere Ansprüche wachsen. Wir wollen glücklich sein, dort, wo wir die meisten Stunden des Tages verbringen; die Arbeit, ein Ort der Selbstverwirklichung. Thomas Vašek geht noch einen Schritt weiter: Der Chefredakteur des Philosophiemagazins „Hohe Luft“ stänkerte mit seiner Abhandlung „Work-Life-Bullshit“ gegen alle, die sich für eine Balance zwischen Berufs- und Privatleben einsetzen. Arbeit weise dieselbe Struktur wie die Liebe auf, schreibt er und erteilt der Dualität von Beruf und Freizeit eine Absage. Stimmen aus der HR-Community mutmaßten, dass Vašek wohl keine Kinder, geschweige denn eine Frau habe.
Lieben Sie Ihren Beruf?
„Wenn ich das Wort Liebe gebrauche, dann nur auf die Liebe zum Journalismus bezogen. Sie hat mich nie losgelassen“, sagt ein Kommunikator, der in der ersten Hälfte seines Berufslebens Journalist war. „Liebe ist nichts, was ich mit einem Job in einem Unternehmen in Verbindung bringe.“ Da Motive für Jobwechsel ein heikles Thema sind, möchten er und ein weiterer Gesprächspartner nicht namentlich genannt werden. Daher heißen sie hier schlicht der „Wechsler“ und der „Treue“.
Seine erste Stelle als Kommunikationschef in einem Chemieunternehmen trat der Wechsler vor zehn Jahren an. Er wurde durch einen PR-Verantwortlichen des Unternehmens abgeworben, mit ihm hatte er als Journalist viel zu tun. Das Angebot lockte ihn. „Als Journalist stellte ich oft fest, wie ungelenk sich Unternehmen im Umgang mit Medienvertretern verhalten. Mich hat es damals gereizt, zu schauen, ob ich dem Unternehmen helfen kann.“ Vergeblich versuchte er, die Kommunikation zu verändern. Für ihn wurde der Jobwechsel ein Wechsel von der Liebe zur Vernunft – dieser sei schrecklich gewesen. Und auch nicht sein letzter.
Der Einstieg in einen neuen Job ähnelt dem Kennenlernen zwischen zwei Menschen. Die Euphorie des Neubeginns wird getragen von Erwartungen und Hoffnung. Man blickt auf seine Rolle und überlegt, wer bin ich? Und noch viel wichtiger, wer möchte ich sein? Mit allen Idealen im Gepäck versucht man alles richtig zu machen.
Der Wechsler verließ damals das Chemieunternehmen, weil er merkte, dass er es nicht würde ändern können. „Ich wollte auch nicht, dass es mich verändert“, sagt er. „Wir haben nicht zusammengepasst, auch wenn das Unternehmen nichts falsch gemacht hat. Deswegen bin ich gegangen.“ In seiner nächsten Position leitete er die Presseabteilung eines Dax-Konzerns. Das ging so lange gut, bis der neue Kommunikationschef kam. „Wir waren kein Team. Er hatte eine ganz andere Agenda als ich und unternahm vieles im Alleingang“, erinnert sich der Wechsler. „Er verstand sich eher als Bodyguard des Vorstandsvorsitzenden, weniger als Kommunikationschef des Unternehmens. So konnte ich kein informierter Ansprechpartner für Journalisten sein.“
Manchmal merken wir, dass unsere Beziehung nicht dem standhält, was wir uns wünschen. Wir werden im buchstäblichen Sinn enttäuscht. Und müssen überlegen, ob wir uns ändern oder gehen wollen.
Es geht also nicht nur um die Beziehung zum Unternehmen, es geht vordergründig um die Verbindung zum Chef. „Kommunikationschefs entscheiden sich für ein Unternehmen und für einen Chef“, sagt Gabriele Kaminski von der GK Unternehmens- und Personalberatung. „Es hängt von den beiden Charakteren ab, ob diese Form der Partnerschaft funktioniert. Der Kommunikationsmanager kann seine Beratungsqualität nur entfalten, wenn der CEO ihm vertraut.“ Ansonsten bröckelt die emotionale Bindung zum Job.
Die Gründe für Jobwechsel, die sich aus Hintergrundgesprächen ergeben, sind zwar nicht repräsentativ, weisen jedoch in eine deutliche Richtung: Versprechen, die bei Stellenantritt gemacht wurden, werden nicht eingehalten, Kompetenzen wieder zurückgenommen. Freiheiten werden nicht gewährt, Hierarchien zu streng gelebt, es wird zu wenig Vertrauen geschenkt. Es sind diese grundlegenden Dinge, die im eigenen Erleben darüber entscheiden, ob man dem Unternehmen Tag für Tag seine Zeit und Kraft schenken möchte.
Ebenso wie der Dreiklang Freiheit, Austausch und Vertrauen jeder Partnerschaft Basis und Glück schenken kann, brauchen wir diese Werte auch im Beruf, um die Bindung zum Unternehmen aufrecht zu erhalten.
Gabriele Kaminski rät allen CEOs, ihre Kommunikationschefs unbedingt in alle grundlegenden operativen und strategischen Prozesse einzubinden. Menschen mit singulären Aufgaben zu betrauen, ohne dass sie in die Strategie einbezogen werden, könne sehr demotivierend sein.
Putting Lipstick on a Gorilla
Wie viel Macht hat also ein Kommunikator? Ein Kenner der Branche und langjähriger Kommunikationschef, der Treue, formuliert es so: „Die CEOs sind dadurch mächtig, dass sie ihre Macht nicht ausüben. Die größte Lüge ist, wenn sie sagen: ‚Ich kommuniziere.‘ In Wirklichkeit meinen sie: ‚Ich erzähle.‘ Dabei wissen wir erst durch Zuhören, was die Stakeholder wollen, und die Kommunikatoren müssen diese Stimmen in die Meetings der Vorstandsetage tragen. Das sind die Kräfte, die Druck auf das Management ausüben.“ Die Gattung PR sei dabei völlig unwichtig, die Kommunikation jedoch fundamental. „Wenn Sie ein schlechter Manager sind, helfen auch HR und PR nichts. Man kann gute Führung nicht delegieren.“ PR und HR werden bei schlechtem Management zum berühmten Lippenstift auf dem Gorilla.
Der Dialog ist also entscheidend. Personalberaterin Kaminski untersuchte einmal in einer Studie für einen Klienten, welche Formate der Internen Kommunikation die Mitarbeitern tatsächlich erreichen. „Das Ergebnis war so simpel“, sagt sie und lacht. „Es waren nicht die ganzen ausdifferenzierten Maßnahmen der Internen Kommunikation, die tatsächlich ankamen. Es war das, was der Chef sagte, der sich vor seine Mitarbeiter stellte und den Dialog suchte.“ Seine Worte haben sich die Mitarbeiter gemerkt.
Am dialogscheuen Kommunikationschef scheiterte es bei dem Wechsler aus dem Dax-Konzern. Er hielt es dort nur zwei Jahre aus und suchte mehr Freiheit in einer Kommunikationsberatung; dafür wurde etwas anderes gekappt: seine Freizeit. „Ich verbrachte meinen Urlaub in Spanien arbeitend im Hotelzimmer“, sagt er. Nach drei Jahren begab er sich wieder auf die Suche.
Bei einem internationalen Industrieunternehmen sollte er die Interne und Externe Kommunikation enger verbinden. Er hatte Freude an seiner Position und erreichte viel. Doch nach einem Jahr wurde der Konzern umorganisiert, auch die Kommunikationsabteilung erheblich verändert. „Damit konnte ich meine eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllen“, sagt der Kommunikator. Er kündigte an, sich auf dem Markt umzuschauen und Bescheid zu geben, wenn sich etwas ergibt. Und nach einigen Monaten hatte sich etwas ergeben und das Unternehmen verlor ihn. Keine sehr feinfühlige Personalführung.
Liebe oder verliere
„Lesen Sie „Love ‘Em or Lose ‘Em“, das ist das wichtigste Buch über Mitarbeiterführung“, lautet ein Tipp des Kommunikationschefs, der seit vielen Jahren glücklich in seinem Unternehmen ist. Außerdem solle man als Kommunikator unabhängig vom CEO sein, und nicht wechseln, wenn dieser das Unternehmen verlässt. „Ich werde nicht vom Vorgesetzten bezahlt, sondern von den Kunden“, sagt der Treue. „Den Stakeholdern gilt meine Loyalität.“ Ein Blick in den zeitlosen Ratgeber über Bleibegespräche von Beverly Kaye und Sharon Evans zeigt, die Beziehungen zu seinen Mitarbeitern brauchen ebenso filigranes Einfühlungsvermögen wie Partnerschaften. Der englische Titel „Love ‘Em or Lose ‘Em“ verdeutlicht diese Dringlichkeit etwas eindrucksvoller als die nüchterne Entsprechung „Die Kunst, gute Mitarbeiter zu halten“. Die Autoren zeigen mit verblüffender Einfachheit, wie man ein besserer Chef, ein besserer Mensch wird. Sie geben Tipps, wie man Bleibegespräche strukturiert, sein Wissen teilt und ein guter Mentor ist. Sie fragen, ob man Vernetzer oder Isolierer sei, und zeigen, wie man Macht abgibt, indem man Fragen stellt, anstatt Antworten zu liefern.
Wie tief die emotionale Bindung an ein Unternehmen ist, steht und fällt auch immer mit den unternehmenseigenen Förderern. Antje Lewe hat in diesem Punkt Unterstützung bekommen. Die 35-Jährige hat 1998 ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei Continental angefangen und ist heute Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei dem Tochterunternehmen Contitech. „Bei einem kleineren Unternehmen wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Hier kann ich meine langjährige Erfahrung mit internen Wechseln kombinieren. Dadurch war es nie langweilig“, sagt Lewe. Sie begann als PR-Assistentin, studierte nebenbei BWL, wurde später PR-Referentin, bis der Pressesprecher sich mit einer Agentur selbstständig machte und sie als Nachfolgerin vorschlug. Ihr wurde zuvor das Krisenmanagement anvertraut, der Leiter Medien lernte sie an, nahm sie zu wichtigen Gesprächen mit, bot ihr Weiterbildungen an – und löste damit die Vorhaben aus den jährlichen Entwicklungsgesprächen ein.
In Beziehungen gibt es einen Punkt, an dem man angekommen ist, sich eingerichtet hat. Rituale sind etabliert, man sucht nicht länger, man erlebt. Doch ohne gut dosierte Veränderungen kann aus liebgewonnenen Ritualen graue Routine werden.
Mitarbeiter fragen sich dann ebenso wie Partner einer Liebesbeziehung: „Bin ich etwas Besonderes? Bin ich ersetzbar?“ Jeder sehnt sich danach, beachtet zu werden. Luca Caracciolo schreibt im aktuellen „T3N Magazin“, dass sich Mitarbeiter den Beteiligungsgrad, den sie aus den sozialen Medien kennen, auch am eigenen Arbeitsplatz wünschen. „Mitsprache und Beteiligung sind quasi ihr Modus Operandi, digitale Technologien ihr Werkzeug“, heißt es weiter. Auch der Essay von Wolf Lotter in der aktuellen „Brandeins“ weist in diese Richtung, er spürt dem Übergang von Führung zu Leadership nach: Führung bedeute nicht mehr, das Arbeitsleben seiner Mitarbeiter zu organisieren. Sie seien längst hoch qualifizierte Wissensarbeiter und damit selbst zu Entscheidern auf ihrem Gebiet geworden. Leadership ist laut Lotter die Fähigkeit, andere selbstlos zu fördern. Doch viele seien schnell beleidigt: „Das Wappen der kleinen Könige ist die Leberwurst“, fügt er süffisant hinzu. Richtiges Führen bedeute – und an dieser Stelle zitiert Lotter den Managementtrainer Reinhard K. Sprenger: „Finde die Richtigen, vertrau ihnen, fordere sie heraus, rede oft mit ihnen, bezahle sie fair und mach dann das Wichtigste von allem: Geh aus dem Weg. Denn die einzige legitime Form von Mitarbeiterführung ist die Selbstführung.“ Steht der Chef im Weg, ist es oft an der Zeit, zu gehen.
Manche Beziehungen hören irgendwann auf, uns gut zu tun. Wir werden am Wachsen gehindert. Wir fragen uns, was will ich?
Doch wie treffe ich eine Entscheidung? Vor allem wenn ich schon viel Energie in den Job gesteckt habe? York Hagmayer schreibt in „Denkfallen – Klug irren will gelernt sein“, es sei ein Trugschluss, bei Entscheidungen auf bereits Investiertes zu schauen. Die Zukunft zählt und man sollte sich nicht von bewussten – rationalen und fremdbestimmten – Zielen in die Irre führen lassen, sondern auch die unbewussten berücksichtigen. „Einen Hinweis geben uns unsere früheren Entscheidungen und wie glücklich wir mit den Resultaten waren“, schreibt Hagmayer. Unsere Entscheidungen sagen etwas über uns aus, sie legen frei, wie wichtig wir uns selbst sind.
So zu entscheiden, das wir glücklich sind, schadet dem Lebenslauf nicht. „15 Jahre im selben Laden würden mich stutzig machen, aber auch bei meinem – auf den ersten Blick unsteten – Lebenslauf verstehe ich, wenn einer stutzig wird“, bilanziert der Wechsler heute nach einigen Jobstationen und lacht. „Wichtig ist, dass ich konsequent lebe und mir klar darüber bin, was ich machen will. Was ein Personaler darüber denkt, ist dann eigentlich egal.“ Gabriele Kaminski rät, man solle sich mindestens drei bis fünf Jahre nehmen, um einen guten Job machen zu können. „Eine neue Position sollte außerdem in die Logik des Werdegangs passen, und bei einem Sidestep eine inhaltliche Erweiterung sein; oder einen Schritt nach vorn bedeuten. Außerdem rate ich jedem, seine Wechselambitionen sachlich zu ergründen, um im Bewerbungsgespräch knapp und schlüssig darüber sprechen zu können“, sagt sie. Klingt plausibel, beim ersten Date sprechen wir schließlich auch nicht über Himmel und Hölle mit dem Ex-Partner, hoffentlich.
„Es ist alles gut, was einen frisch hält“, sagt Gabriele Kaminski. Und uns hält frisch, was wir nicht kennen. Das romantische Prinzip, das Bekannte fremd erscheinen zu lassen, gilt für den Job wie für die Liebesbeziehung. Und das Ambivalente am Fremden ist, dass es neugierige Menschen noch neugieriger macht und ängstlichere eher beunruhigt. Sie sichern sich ab, vermeintlich, und machen ihr Leben damit bedeutend ärmer.
Die Liebe lässt sich nicht ignorieren, lautet übrigens das tröstende Fazit von Alain de Bottons Romanhelden. Das sollte auch für die Liebe zu uns selbst gelten, wenn wir vor der Entscheidung stehen, Ja oder Nein zu einem Unternehmen zu sagen.