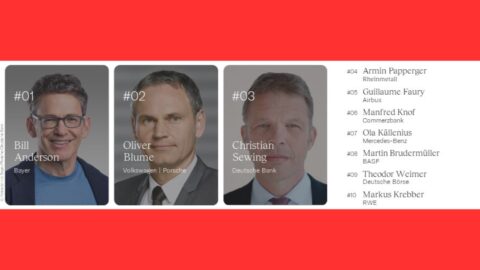Herr Frank, Sie haben auf der 9. Fachtagung Krisenkommunikation der depak von menschlichen Faktoren in Notfallsituationen gesprochen. Was ist daran so gefährlich?
Mark Frank: Der Faktor Mensch setzt sich zusammen aus verschiedenen Dingen: Zum einen aus all dem, was man in der Vergangenheit erlebt hat und was unbewusst eine Rolle spielt – und dem was dazu kommt, wenn man eine Situation als Notfall wahrnimmt und plötzlich Stress fühlt: Die Adrenalinausschüttung führt dazu, dass der Geist nicht mehr benutzbar ist und man nicht mehr so auf Ressourcen zurückgreifen kann, wie man es gewohnt ist und sich wünscht.
Das verändert komplett alle Bedingungen und ist das Gefährliche am Faktor Mensch: Nämlich ob man es auch dann schafft, wenn man nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte ist, einen Schritt zurück zu treten und sich zu befreien vom ersten Stress. Nur dann kann man gute Entscheidungen treffen und Dinge leichter re-evaluieren.
Man muss sich klar machen, dass es in vielen Situationen kein „Richtig“ oder „Falsch“ mehr gibt. Und dass es Situationen gibt, die man nicht verbessern kann. Man darf diesen Gedanken zulassen. Was nicht heißt, dass man es nicht versuchen soll … Nicht jeder Notarzt kann alles zum Guten wenden, auch wenn er es möchte.
Die nächste Gefahr ist das eigene Ego: Wie werden Entscheidungen getroffen? Sind sie vor allem dazu da, sich selbst in ein gutes Licht zu rücken für die Zeit, wenn der Stress vorbei ist? Oder arbeitet man in der Krise wirklich am Menschen, an der Situation, an dem Problem und versucht, mit allen Möglichkeiten und Ressourcen eine Verbesserung herbei zu schaffen?
Der Faktor Mensch führt dazu, im Stress Entscheidungen zu treffen, die nicht unbedingt gut sind, weil sie zum Beispiel aus der Angst vor juristischen Auseinandersetzungen heraus getriggert sind. Das Vorausdenken darüber, was NACH der Situation sein wird, spielt eine viel zu große Rolle. Wir brauchen gerade bei Großschadenslagen unkonventionellere Entscheidungen, nach denen wir einfach das Problem bearbeiten für eine gute Lösung, die allen bestmöglich hilft.
Reiste kurz nach dem Interview weiter für einen Vortrag in Kapstadt: Mark Frank (c) Laurin Schmid
Macht ein Notfalltraining dann überhaupt noch Sinn, wenn wir im Extremfall eh auf die Essenz unseres Wesens zurückgeworfen sind?
Absolut. Training bewirkt – und das ist gut nachweisebar –, dass man sich erstens diese Einflussfaktoren bewusst macht und zweitens fällt es beim nächsten Mal leichter, den Notfall zu re-evaluieren, wirklich einen Schritt zurück zu treten und die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Allein schon, physikalisch ein paar Meter weiter zu gehen, ist schon Gold wert, um eine Situation anders zu beurteilen. Und das schafft man durch Training sehr gut.
Ein Beispiel: Wenn wir Notärzte in ein Simulationszentrum schicken, messen wir dort ihre Stresshormonausschüttungen. Zuerst sind die sehr hoch, aber wenn sie die Notfälle zwei, drei Mal im Jahr trainieren, ist der Pegel nur noch halb so hoch. Training hilft dabei, Lähmendes, den Geist Vernebelndes etwas schneller abzulegen, um am Ende gute Entscheidungen zu treffen und um all mein Wissen und Können auch einzusetzen, was mir sonst im Stress komplett verloren gehen kann.
Wer ist der bessere Helfer: Der mit dem kurzen Erwartungshorizont, der nur die nächste Stunde überleben will und sich auf seine Instinkte verlässt – oder derjenige, der verkopft seine Notfall-Checkliste abarbeitet?
Weder noch. Einerseits ist die Distanz zum Ereignis, zu den Angehörigen, zu dem Notfall vielleicht gar nicht schlecht, um medizinisch professionell zu arbeiten. Andererseits verliert man dabei seinen menschlichen Mantel.
Warum ist der überlebensnotwendig?
Der menschliche Mantel gibt denen, die man führt und denen, für die man da sein soll, ein Stück weit die Nähe, die ihnen und der Situation gut tut. Jemand, der alles perfekt man, ist in der Krise nicht derjenige, der gut führt, weil er den anderen Angst macht. Wenn ich aber sage, „ich weiß nicht weiter, bitte helft mir“ und trotzdem selbst die Verantwortung trage, haben die anderen die Chance, sich einzubringen.
Und wer ist der bessere Kommunikator?
Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn der Profi einer Unternehmenskommunikation an einer Notfallsituation ganz nah beteiligt ist und ob er seinen Job noch professionell machen würde. Wenn ich Nachrichten sehe, ist die Mehrzahl der Meldungen dazu geeignet, dass ich abschalte.
Tun Sie das auch?
Ja.
Weil Sie eh jeden Tag Notfälle erleben?
Weil es mich nervt. Weil es ein durchdachtes Konstrukt ist, wie man Dinge formuliert, damit das Unternehmen gut dasteht und keine Kunden oder Aufträge verliert. Das hat mit der Wahrheit nur imaginär etwas zu tun.
Sie vermissen die Wahrhaftigkeit?
Ja. Definitiv.
Kann man dem Kunden denn die Wahrhaftigkeit immer zumuten?
Das ist eine Entscheidung, die nicht ich treffen möchte. Sondern eine, die der Kunde selbst treffen sollte. Das ist wie die Regierung, die sagt, was sie machen, tue uns gut – aber es sind Dinge, die wir vielleicht gar nicht wollen. Sie trifft Entscheidungen für uns, von denen ich denke, „warum haben sie mich nicht gefragt?“, weil sie davon ausgehen, dass wir nicht mündig genug sind, darüber zu entscheiden.
Das Leben ist, wie es ist. Ich finde, dass wir nicht selektieren sollen, was zumutbar ist. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen wie bei Meldungen zu Suiziden, weil die Nachahmer provozieren. Ich persönlich glaube, dass es ein großes graues Feld ist zwischen der aktuellen Situation und der Wahrhaftigkeit. In der Kommunikation klaffen Anspruch und Wirklichkeit oft auseinander. Ich habe schon viel in der Unternehmenskommunikation gesehen und für viele Mitarbeiter in Pressestellen ist das ein Spagat, der ihnen die Seele quetscht.
Der Mediziner sieht Parallelen zwischen Notfallmedizin und Krisenkommunikation (c) Laurin Schmid
Aber sie haben es sich ausgesucht.
Und es ehrt jeden, der noch darüber nachdenkt, ob die Dinge so vermittelbar sind oder nicht. Aber in vielen Unternehmensbereichen – gerade im Krankenhausbereich –, liegt der Fokus zu sehr auf dem Euro anstatt auf der Problemstellung an sich. Aber man kann etwas dagegen tun, indem man sich zusammentut und „Nein“ sagt: Wir sind nicht dafür da, dass ein Unternehmen bestmöglich dasteht, dafür gibt es die Marketing-Abteilung. Eine Unternehmenskommunikation sollte in meinen Augen andere Aufgabe haben: Sie sollte vermitteln und nicht ein Unternehmen werbemäßig abbilden.
Ich würde mir auch wünschen, dass man diesbezüglich mehr gemeinsam macht: Damit Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation in Krankenhäusern viel mehr in medizinische Prozesse involviert sind und anders herum Ärzte und Pflegekräfte davon profitieren, sich mit Kommunikationsspezialisten auszutauschen. Wieso gibt es keine Aufklärung für Angehörige von Verstorbenen? Weil wir keine Ahnung davon haben. Es geht bei uns wie in der Unternehmenskommunikation darum, aufmerksam zu bleiben und zuzuhören. Kommunikation geht in zwei Richtungen, dazu gehört auch das Hinschauen, das Zuhören und Wahrnehmen. Aber das ist verstummt.
Das ist ganz schön viel auf einmal.
Das finde ich nicht. Wir sollten uns immer fragen: Was ist meine Motivation beim Zuhören? Will ich mir dabei gedanklich schon zurechtbauen, wie ich mich danach positioniere? Oder geht es mir wirklich um das HINhören, mich also aktiv in Richtung des anderen zu bewegen? Gerade die Unternehmenskommunikation hat da eine Schlüsselposition, sie kann Vermittler sein zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitern. Sie hat das Ohr am Volk, kann Sensor sein und die Hand ausstrecken, das ist auch in Krisen eine Chance. Aber wann hat die UK im Krisenstab oder in Meetings zuletzt wirklich zugehört? Sie haben sich immer nur ge-äußert und gesendet.
Wir sind also weit weg von einer Annäherung. Es wird immer mehr um die Euros gehen und das lässt sich nur schwer aufhalten. Dabei müsste man sich „nur“ formieren, zusammenhalten und in eine Richtung gehen. Doch was steht dem entgegen: Das Ego. Denn einer reicht, der sagt: „Geht ihr mal alle in die Richtung, ich nehme die andere und mach Karriere“.
Wer ist der bessere Kommunikator: Der Arzt, dem man beibringt zu kommunizieren oder ein Kommunikator, der nebenbei lernt, was ein Politrauma ist?
Ich glaube, dass das keine Rolle spielt, wenn die Einstellung zur Sache stimmt.
Hat sich Ihre Wahrnehmungsschwelle für Krisen mit den Jahren verändert?
Ja.
Sie zucken heute also nicht mehr bei jedem weinenden Kind, solange es nicht blutet?
Im Gegenteil. Ich bin viel sensibler geworden und das geht der Mehrzahl meiner Kollegen auch so. Das Klischee ist doch, dass man als Notarzt längst abgehärtet ist. Never, es wird immer schlimmer. Denn wir werden älter und unsere „Unsterblichkeit“ wird jeden Tag in Frage gestellt. Wir werden ständig daran erinnert, dass Zeit ein wichtiges Gut ist.
Ich habe in den ersten Jahren viel zu sehr mit der Medizin gekämpft, um alles richtig zu machen. Wenn man irgendwann alles tut, um bestmöglich performen zu können, jeden Kurs besucht und jede Notfallsituation mitnimmt, dann ist zwar weiterhin jeder neue Fall eine Herausforderung, aber es gibt mir auch die Freiheit, über das Medizinische hinaus zu schauen. Ich nehme heute zum Beispiel die Angehörigen, ihre Sorgen und Nöte viel mehr wahr als ich es am Anfang tat.
Gibt es eine Sollbruchstelle?
(schweigt lange) Heißt?
Könnte der Tag kommen, an dem Sie aufhören, weil Ihnen die Fälle ZU nah sind?
Ja, die gab es auch schon.
Und was haben Sie getan?
Ich bin vorübergehend ausgestiegen. Es gibt schon Situationen, die einem sehr nah gehen. Wenn man den Gedanken zulässt, dass man Fehler macht. Ärzte sind nicht kritikfähig. Es tut natürlich weh, wenn man sich vor Augen halten muss, dass man dafür verantwortlich ist, dass etwas schief gegangen ist und dadurch ein Mensch Schaden genommen hat oder gestorben ist. Das ist ganz schwierig. Aber wenn man es schafft, mit einer gewissen Kritikfähigkeit zu leben, kommt als nächster Schritt wieder ein Stück Freiheit. Und nach einer gewissen Abstinenz durch eine solche Auszeit fällt einem auch auf, dass man nichts anderes gelernt hat (lacht).
Mark Frank im Gespräch mit pressesprecher-Chefredakteurin Hilkka Zebothsen (c) Laurin Schmid
Sie könnten doch auch was anderes machen.
Ja, gärtnern vielleicht, mit Blumen reden. Aber es gibt ja auch eine Menge heilende und schöne Situationen, die man bei allem Unglück nicht vergessen darf. Und das ist die Mehrzahl. Sonst würde das nicht gut tun. Medizin ist ein unglaublicher toller Beruf, der zwar mit vielen Klischees behaftet ist, von denen viele auch zutreffen, aber es ist auch an uns, die Bedingungen so zu bauen, dass es passt.
Erinnern Sie sich noch an ein kommunikatives Aha-Erlebnis aus Ihrem Alltag?
Ich weiß nicht mehr, wann genau ich das begriffen habe, aber gerade aus dem Unterricht und aus Vorlesungen habe ich gelernt, dass Medizinstudenten – wie alle anderen auch – den perfekten Arzt gar nicht wollen.
Autsch!
Sie alle wollen vor allem Empathie. Die Hand auf der Schulter heilt. Aber Empathie und Nähe kann man nicht lernen. Und wir brauchen eine neue Fehlerkultur. In der Uniklinik Dresden bot ich vor Jahren mal Fallvorstellungen in der Notfallmedizin an, abends um 18 Uhr und freiwillig. Ich schrieb also Folien, besorgte einen Overhead-Projektor und Kinder-Riegel zur Bestechung und reservierte einen Raum für 20 Leute. Am Ende kamen 250. Und alle hörten zu, wie ich von meinen Fehlern berichtete, die ich im Rettungsdienst gemacht hatte. Ich war zuerst nicht sicher, ob das eine gute Idee ist aber erhielt danach eine Flut von Mails und Briefen von Studenten. Einer schrieb: „Ich bin jetzt seit vier Jahren im Studium und das war das erste Mal, dass einer sagt, dass er Fehler macht.“
Mediziner sind darauf geeicht, dass sie niemals sagen sollen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das ist ein gesellschaftliches Problem, weil die Versicherungen sonst nichts zahlen. Das ist eine Katastrophe. Denn es ist Elixir und lebenswichtig, dass wir nicht einen Millimeter der Ehrlichkeit preisgeben. Aber das tun wir jeden Tag. Trotzdem arbeite ich für mich daran, den Kontakt zu Patienten und Angehörigen zu suchen, auch wenn ich etwas nicht richtig gemacht habe und ihnen zu erklären, wie es dazu kam. Ich habe hohes Risiko auf mich genommen – aber es war jedes Mal eine positive Erfahrung.
Wurde Sie nie verklagt?
Nie. Im Gegenteil, ich habe bis heute noch Kontakt zu Angehörigen, die das besonders und anständig fanden. Wenn jemand Schaden nimmt, steht ihm ja auch etwas zu, zum Beispiel weil jemand einen bleibenden Schaden hat und seine Wohnung verlassen oder umrüsten muss. Ich bin auch nur ein Mensch. Wenn wir ehrlich wären und besser kommunizieren würden, würden 95 Prozent aller Klagen nicht passieren.
Was ist Ihr Tipp, um mitten in der Krise die Kontrolle zurück zu bekommen – oder wenigstens den Atem?
Ein guter Freund von mir ist Psychologe. Der sagt in Krisenzeiten gerne: „Komm in die Hütte“. Man kann das trainieren, aber es gelingt nicht immer. Ich drücke sonst auch gerne einen Punkt zwischen Daumen und Zeigefinger, schließe die Augen, atme zehn Sekunden lang aus und lasse alles um mich herum geschehen. Meine Rettungsassistenten vom Hubschrauber kennen das schon und lassen mich dann in Ruhe, weil ich mir damit meine innere Stärke zurück hole und versuche, alle menschlich empathisch an Bord zu bringen. Ich habe eher nach der Krise das Problem, dass mich alles einholt. Der Stress, den ich vorher versucht habe zu vermeiden, kommt hinterher doppelt zurück.
Aber Sie nehmen die Hütte in sich immer mit, oder?
Ich habe sie immer dabei, aber es klappt nicht immer.
Und was dann?
Dann habe ich ein Team.