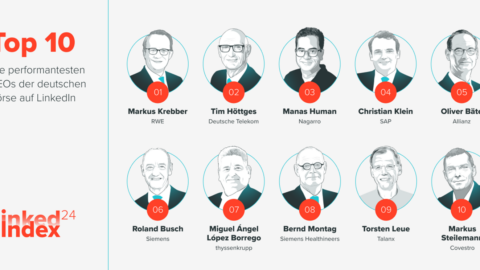Herr Professor Wehner, warum ist es uns so unangenehm, wenn uns ein Fehler unterläuft?
Theo Wehner: Wer von Fehlern spricht, spricht eigentlich vom Handeln. Dass Lebewesen, die Ziele ansteuern und nicht nur mit Reflexen auf die Umwelt antworten, auch oft das Anvisierte verfehlen, ist mehr als erwartbar – es ist menschlich. Damit bricht das Handeln aber nicht ab. Es folgt, was wir als Lernen oder Einsicht gewinnen benennen. Wenn man Fehler auf diese Weise betrachtet, erscheint es absurd, dass sie – vor allem in der westlichen Welt – in Form von Scham und Peinlichkeit rote Ohren hinterlassen. Stattdessen sollten sie Erstaunen auslösen! In der Praxis sieht das jedoch oft anders aus: Wenn ich meinen Koffer packe und selbstverständlich das Ziel habe, alles, was ich brauche, mitzunehmen und am Zielort merke, ich habe die Kulturtasche vergessen, dann staune ich nicht darüber, wie mir das passieren konnte. Stattdessen bin ich verärgert und suche Schuldige, zum Beispiel die Kinder, die mich beim Packen abgelenkt haben.
Die Konnotation von Verfehlungen mit Schuld und Verärgerung bekommen wir doch auch von klein auf anerzogen. Das Kind, das in der Schule fünf Fehler im Diktat gemacht hat, wird üblicherweise mit einer schlechteren Note bestraft …
Ja, dabei bedeuten diese fünf Fehler doch eigentlich, dass der Schüler fünf Lernchancen hat. Fünf Anknüpfungspunkte, von denen aus er sein Wissen – mit pädagogischer Unterstützung – erweitern kann. Kein Kind kann eine Sprache von Anfang an perfekt. Interessant ist aber: Im frühkindlichen Alter werden Versprecher noch als amüsant oder niedlich empfunden. Bereits im Kindergarten treten wir jedoch in eine Leistungsbewertung ein und spätestens in der Schule wird so getan, als wüssten alle genau, was richtig und falsch ist. Dabei ist beispielsweise unsere Sprache auch nur durch Abweichungen vom Usus entstanden. So war es schließlich keine demokratische Entscheidung, sich vom Mittelhochdeutsch zu verabschieden, sondern ein schleichender Prozess. Auch Technik und Medizin haben sich auf diese Art entwickelt: Wie und an welcher Stelle man heute eine Operationsnaht setzt, hat man aufgrund der aufgeplatzten Nähte und der Korrekturen herausgefunden.
Ein solches Handeln entspricht doch dem Prinzip „Trial and Error“: Ich probiere verschiedene Methoden aus und schaue, welche zum Ziel führt. Besonders bei Start-ups ist dieses Vorgehen oft das Mittel der Wahl. Macht es auch bei etablierten Unternehmen Sinn?
Mit diesem Prinzip gestehe ich zu, dass ich nicht genau weiß, was richtig und was falsch ist. Aufgrund dessen muss ich mich sehr umsichtig im Feld bewegen. Ich kalkuliere unerwünschte Ereignisse ein und das geht nur dann, wenn die Fallhöhe nicht zu hoch ist. Viele Entscheidungen sind im Unternehmen aber keineswegs harmlos: Kaufen wir die Firma auf? Entlassen wir diese Mitarbeiter? So etwas kann man nicht über Trial and Error herausfinden. Gut ist das Prinzip in Innovationsprozessen, in der Laborsituation. Hier ist Raum, um Dinge auszuprobieren. Wenn wir aber Arzneimittel auf diese Weise entwickeln und anwenden würden, wäre das eine Katastrophe!
Bei wichtigen Entscheidungen sollten wir negative Konsequenzen also stärker antizipieren?
Wir müssen immer davon ausgehen, dass uns das Wissen zum Handeln zur Verfügung steht, gleichzeitig aber einsehen, dass dieses nicht allumfassend ist. In dem Dilemma steckt der Mensch grundsätzlich. Handelnde Wesen erreichen ihre Ziele meistens mit Abstrichen: An die Kulturtasche haben Sie beim Packen des Koffers vielleicht gedacht, die Zahnbürste darin fehlt jedoch. Nicht Trial and Error, sondern Fehlerfreundlichkeit ist die Lösung. Das bedeutet, dass man die Auswirkung von Fehlern harmlos hält. Wir wissen: Wenn Menschen Auto fahren, wird es zu Unfällen kommen. Es geht nicht darum, sie vollständig zu verhindern, das ist unmöglich. Aber indem wir unsere PKW mit Airbag und Knautschzone ausstatten, werden die unerwünschten Ereignisse immerhin abgefedert; eine angemessene Geschwindigkeit vorausgesetzt.
Den Spruch „Aus Fehlern lernt man“ kennt jeder. Was kann denn ein Unternehmen tun, um Fehler abzumildern und womöglich einen Nutzen daraus zu ziehen?
Wer aus Fehlern etwas lernen will, muss sie nicht einfach nur gemacht und korrigiert haben, das reicht nicht. Er muss sie reflektieren. Organisationen sollten Foren schaffen, wo man das gemeinsam tun kann. In der Medizin gibt es dafür beispielsweise ‚Fallkonferenzen‘. Hier werden Ereignisse gesammelt, in denen etwas schief gegangen ist und im Team diskutiert. Ursache für die Fehler sind übrigens selten Unwissen oder fehlende Aufmerksamkeit. Ursachen liegen oft auf der strukturellen Ebene, in organisationalen Abläufen, im Zusammenwirken, von Mensch und Technik – selten im Individuum alleine.
Fehler zu vermeiden, ist also keine Frage der Selbstkontrolle?
Naja, man könnte sagen, Aufmerksamkeit verschiebt die Fehlergrenze, aufgehoben wird sie dadurch jedoch nicht. Wenn Sie mit voller Konzentration die Kulturtasche packen, werden Sie wohl an die Zahnbürste denken. Aber der Mensch ist kein Automat. Organisationen tun gerne so, als hätten sie alle Vorkehrungen getroffen, damit keine Fehler passieren. Als hätte der Einzelne sich schlichtweg zu wenig Mühe gegeben. Das allerdings sind Omnipotenzfantasien, die von der Realität weit entfernt sind. In der Fehleranalyse heißt es dann: Wie konnten die Mitarbeiter nur so blöd sein? Das ist die völlig falsche Herangehensweise. Stattdessen sollte man fragen: Warum hat es Sinn gemacht, so zu handeln, wie die Person gehandelt hat? Man sollte ihre Perspektive übernehmen. Die interessante Frage ist also: Warum ist es mir gelungen, die Kulturtasche nicht einzupacken, obwohl ich weiß, dass ich sie benötige?
Gibt es auch ein Zuviel an Aufmerksamkeit?
Natürlich. Die übertrieben aufmerksame Nachrichtensprecherin konzentriert sich nach einem Versprecher so stark auf mögliche weitere Pannen, dass sie sich prompt wieder verhaspelt. Da gibt es schöne Beispiele auf Youtube. Gerade wenn wir uns darauf fokussieren, bloß nichts falsch zu machen, unterlaufen uns oft Fehler. Nehmen wir den Brand des Chemiekonzerns Sandoz in Basel 1986. Dass das Werk brannte, war zunächst einmal keine Katastrophe. Doch dann musste alles richtig gemacht werden, es gab die allerhöchste Alarmstufe. Man hat den Brand also ordnungsgemäß gelöscht aber anschließend das verseuchte Löschwasser in den Rhein gespült. Hier begann dann die eigentliche Katastrophe. So initiiert auch das – in angespannten Situationen gerne von Eltern und Pädagogen geäußerte – ‚Pass doch auf!‘ meistens den nächsten Fehler …
Wenn nun in einem Unternehmen ein Fehler passiert ist, wäre es dann für den Lerneffekt ratsam, ihn im ganzen Team zu besprechen oder sollte man ihn lieber mit dem Verursacher unter vier Augen diskutieren?
Das ist eine sensible Aufgabe. Der Einzelne wird sich vermutlich für seinen Fehler ärgern, womöglich schämen, daher sollten diese Emotionen zunächst mit ihm allein abgebaut werden. Das geht nur, indem man Leistungsansprüche und Schuldvorwürfe komplett ausklammert. Nicht jeder Fehler gehört zwangsläufig ans schwarze Brett. Ist er aber von allgemeinem Interesse und weist er über das individuelle Handeln hinaus, sollten auch alle darüber sprechen.
Finden solche Analysen zu selten statt?
Ja. Leider fällt es Organisationen häufig schwer, zurückzuschauen. Das muss man in der Fehleranalyse aber tun. Es reicht nicht, einen vermeintlich „Schuldigen“ zu suchen. Und auch das berühmte „Schwamm drüber“ ist die falsche Herangehensweise. Fehler verpflichten uns zur Rekursion, zum Schleifen ziehen. Wir können nicht immer nur nach vorne blicken; ein Rückspiegel leistet nicht nur in Fahrzeugen gute Dienste.
Welches Unternehmen verfügt über eine besonders gute Fehlerkultur?
Ein einzelnes kann ich da nicht nennen. Aber im Branchenvergleich schneidet die Aviatik gut ab. Das Fliegen ist ja eine vergleichsweise junge Technik. Wenn man die Unfallquoten aus den 1950er Jahren mit den heutigen vergleicht, kann man eine riesige Verbesserung feststellen. Das konnte nur gelingen, weil jeder einzelne Absturz ganz genau auf seine Ursachen hin untersucht wurde. Hier kommt das Critical Incident Reporting her, die Fehleraufmerksamkeit ist enorm. Auch in der Medizin ist viel passiert. In diesem Bereich wurden Fehltritte lange streng tabuisiert und wenn sie auftraten, wurden sie als ‚Kunstfehler‘ geadelt. Inzwischen ist das anders.
Deutschland gilt oft als streng in Bezug auf berufliche Patzer. Sind wir hierzulande besonders intolerant, was Fehler betrifft?
Ja. Überall da, wo der Leistungs- und Perfektionsanspruch sehr hoch ist, gelten auch Fehler stets als Versagen und Kränkung. Amerikaner sind beispielsweise viel pragmatischer. Nach einer Verfehlung bleibt man entspannt und korrigiert sie. Auch in Japan kann man gut damit leben, zwei Schritte vor und einen zurück zu gehen. Dort vertraut man auf das ‚Kaizen’-Prinzip – den ‚Weg zum Guten‘ – und setzt den Fokus auf Verbesserung. Hier erwarten wir, alles müsste mit dem ersten Wurf gelingen. Im Ausland habe ich, wenn es um dieses Thema ging, oft gehört: ‚You need someone to hang‘ – ihr braucht zuerst einen Schuldigen. Das ist natürlich kontraproduktiv, denn ein solches Denken erzeugt Angst und diese ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber.
Wenn Kunden von Fehlern betroffen sind, prangern sie die „Schuldigen“ häufig im Internet an. Ist es im digitalen Zeitalter mit seiner ausgeprägten Feedbackkultur für Unternehmen schwieriger geworden, Fehler vor der Öffentlichkeit zu verbergen?
Ein Unternehmen kann seine Fehler heute nicht mehr unter den Teppich kehren – das sollte es ja auch nicht. Wie man sie kommuniziert, ist allerdings um ein vielfaches schwieriger geworden. Wenn Burger King – als aktuelles Beispiel – einen Fehler macht, weiß das auch jeder Vegetarier, der im Internet surft. Alle bewerten die Situation. Das ist wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft: Es gab genauso viele Bundestrainer wie Zuschauer und jeder wusste besser, wo Philipp Lahm spielen sollte. Wenn Zielverfehlungen passieren, gibt es unter den Feedbackgebern zu wenig Bescheidenheit und Respekt vor der Komplexität der fehlerauslösenden Situationen. Es ist überheblich, ja arrogant vorzugeben, mann wisse grundsätzlich, was richtig und falsch ist.
Unsere Fehlerkultur ist also unbescheiden?
Definitiv, und das hilft überhaupt nicht. Denn so wird Reflexion einfach abgewehrt und es gibt keine Bereitschaft, sich mit der Komplexität von Entscheidungssituationen auseinanderzusetzen. Die besten Analysevoraussetzungen habe ich dort mitbekommen, wo Fehler bestaunt wurden. Wenn beispielsweise der Chefarzt seinem Assistenten sagt: Ich weiß nicht, warum der Fehler mir nicht passiert wäre und nicht schon häufiger aufgetreten ist, das müssen wir gemeinsam herausfinden. Das Staunen steht am Anfang, die Erkenntnis am Schluss. Wenn die vermeintliche Kenntnis am Anfang steht, handelt es sich meist um Rechthaberei.
Wann ist Ihnen selbst zuletzt ein Fehler unterlaufen?
Vermutlich in unserem Gespräch gerade. Bestimmt gab es in dem, was ich gesagt habe, einige grammatikalische Fehler oder ich habe Wörter vertauscht. Dass ich mich mit Fehlerforschung befasse, macht mich natürlich nicht dagegen immun. Aber es hilft, gelassener damit umzugehen und das Staunen zu üben.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Fehler. Das Heft können Sie hier bestellen.